Er weint. Mit trockenen Augen. Um die Frau, die er geliebt hat. Die gegangen ist, ohne ein Wort. Kein Geschrei, das ihm alles erklären würde. Nur der Wind in den alten Tannen um das Haus. Ein Eichhörnchen. Ansonsten Stille. Sie hat ihre Sachen mitgenommen, also wird sie nicht ins Wasser gegangen sein. Aber weiß er es. Nein, er weiß es nicht. Er wartet, jeden Tag. Lauscht dem Wind, in den Tannen. Läuft durch den Forst zum Teich. Denkt jeden Tag, der ist zu klein. Und kann doch nicht anders, als die Wasseroberfläche, die Ufer absuchen, jeden Tag aufs Neue. Sie wollte leben, sie wollte sterben, beides gleichzeitig. Vielleicht ist es das, was sie in ihm gesehen hat, gespürt. Er hat nie verstanden, wieso sie so lange bei ihm geblieben ist. Er könnte ihr Vater sein, fast ihr Großvater. Sie hat sich gesehen gefühlt, verstanden, ohne viele Worte. Vielleicht war es dieses Sterben im Leben. Diese Sehnsüchte, in beide Richtungen. Ein Hunger, nach Leben. Ein Sattsein, so gründlich, dass man nicht mal mehr reden musste. Von den Tannen rieseln die Nadeln. Unten sind sie längst kahl. Viel zu dicht gepflanzt, ein typischer Forstwald, wie man ihn früher gepflanzt hatte. Da war sie noch gar nicht auf der Welt gewesen. So jung. Und so alt zugleich. Er hatte sich sofort in sie verliebt. So sehr wie nie zuvor in seinem Leben. So tief und so schmerzhaft, als hätte sie sich eingewurzelt, innen in ihm. Und immer wieder gezogen daran. Bis sie sich rausgerissen hatte. Nach sieben Jahren. Ohne Geschrei. Lautlos. Und gegangen war. Nur mit dem Wind in den Tannen, der geblieben ist, für ihn.
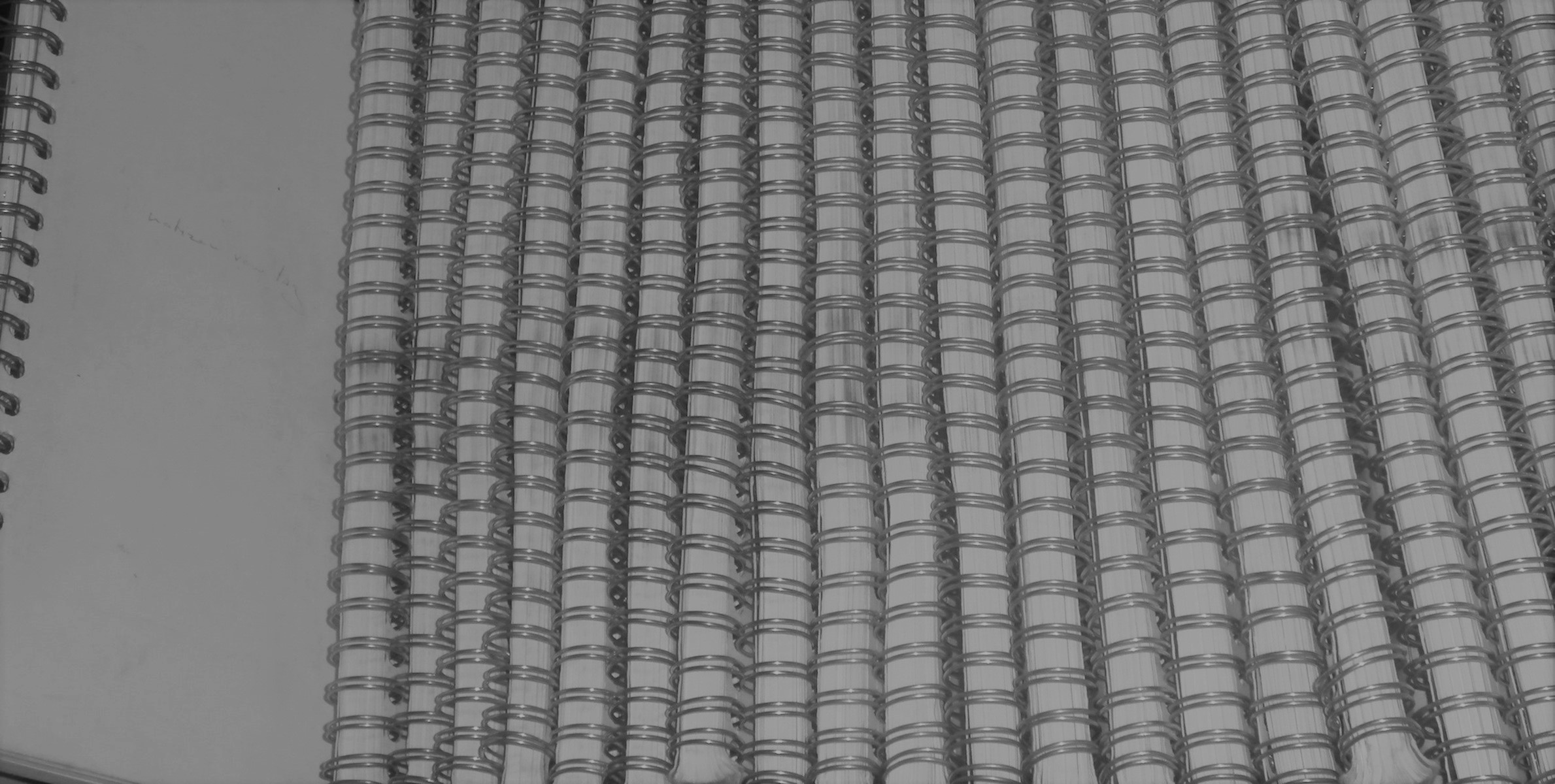
Schriftstellerin