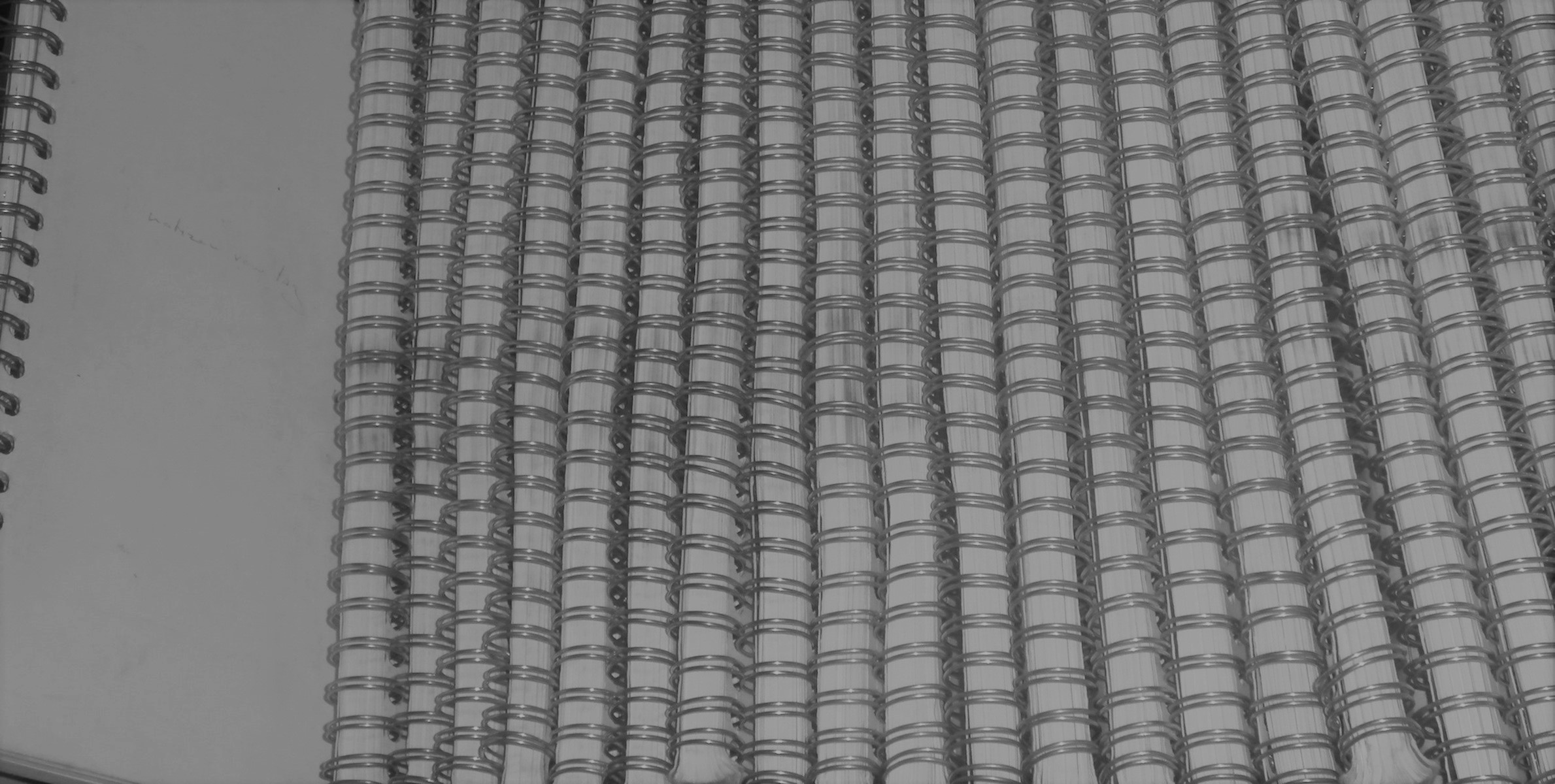Meine Hände am Stift, ein kleines Wunder. Ich konnte den Stift nie so führen wie man sollte. Den Bleistift, den Füller. Immer war mein Zeigefinger eingeknickt, mit viel zu viel Druck. Der harte Knubbel am Mittelfinger, den ich mir immer wieder abgebissen habe, flachgebissen die ganze Hornhaut. Ich habe gerne Hornhaut gegessen, lange auf den Stückchen rumgekaut. Es hat mich beruhigt. Es beruhigt mich heute noch.
Den Knubbel gibt es immer noch, am Mittelfinger. Auch den eingeknickten Zeigefinger. Nur der Druck ist weniger geworden, weicher. Ich schreibe wieder mit Bleistift, wie als Kind, aber mit Druckbleistift, 0,5, fast ohne Druck. Der Stift gleitet weich. Aber das Aufsetzen, dieses ständige Aufsetzen nach jedem zweiten dritten Buchstaben, wo die Buchstaben nicht nahtlos zusammengehängt sind, dieses Aufsetzen ist hart. Und laut. Und schnell. Ein Klopfen, ein Pochen, ein rasendes Herz. Im Rhythmus des Schreibens. Ganzkörperrhythmus. Der Atem passt sich den Sätzen an. Die Bewegungen der Musik. Wie Flöte spielen oder Klavier oder Cello. Nirgends kann ich still stehen, still sitzen. Nur singend. Wenn ich singe, bewege ich mich kaum. Wenn ich singe, werde ich ruhig.
Sogar die Kinder werden ruhig, wenn ich singe. Statt meine wilden Improvisationen, in den Texten, mit den Stiften. Auf dem Klavier, mit den Tasten. Die Saiten, die sich einschneiden. Das Cello so ruhig, und mein Rhythmus so wild, mit dem Bogen über dem Steg. Mit dem Stift auf dem Papier. Und der Specht, im Baum vor dem Fenster. Mitten in der Stadt. In Berlin.
Wenn ich singen könnte, im Schreiben. Singen, jubilieren. In die höchsten Höhen, in die tiefsten Tiefen. Bis die Tiefe nicht mehr beängstigend ist, sondern einfach nur tief und ruhig und dunkel. Bis ich vielleicht schlafen kann, trotz Corona. Und der Sand rieselt weiter, in meiner kleinen Kindersanduhr. In rosa. Ich habe Zeit zum Schreiben. Zeit zum Singen im Schreiben. Zehn Minuten pro Tag.
Wir alle könnten sie uns nehmen, die Zeit. Zum Singen, zum Schreiben, zum Musik machen. Bis wir wieder ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn wir uns begegnen draußen. Noch ohne Mundschutz, zwischen den Bäumen, im Park, zwischen den Häusern, auf der Straße. Ein Lächeln, ein Melodiefetzen, ein Kinderlied. Das leise Grüßen, das leise freundliche Gespräch. Ein feines Nicken, ein Weitersingen. Wir lassen ihn los, den Corona-Stress. Die Spannung. Das Atemanhalten.
Ich schließe die Augen, schreibe blind. Der Stift wird langsam, das Klopfen weich. Der Specht schweigt. Ich werde noch singen, heute, für meine Kinder, wenn ich sie ins Bett bringe. Das Herz ist ruhig. Ich atme wieder.