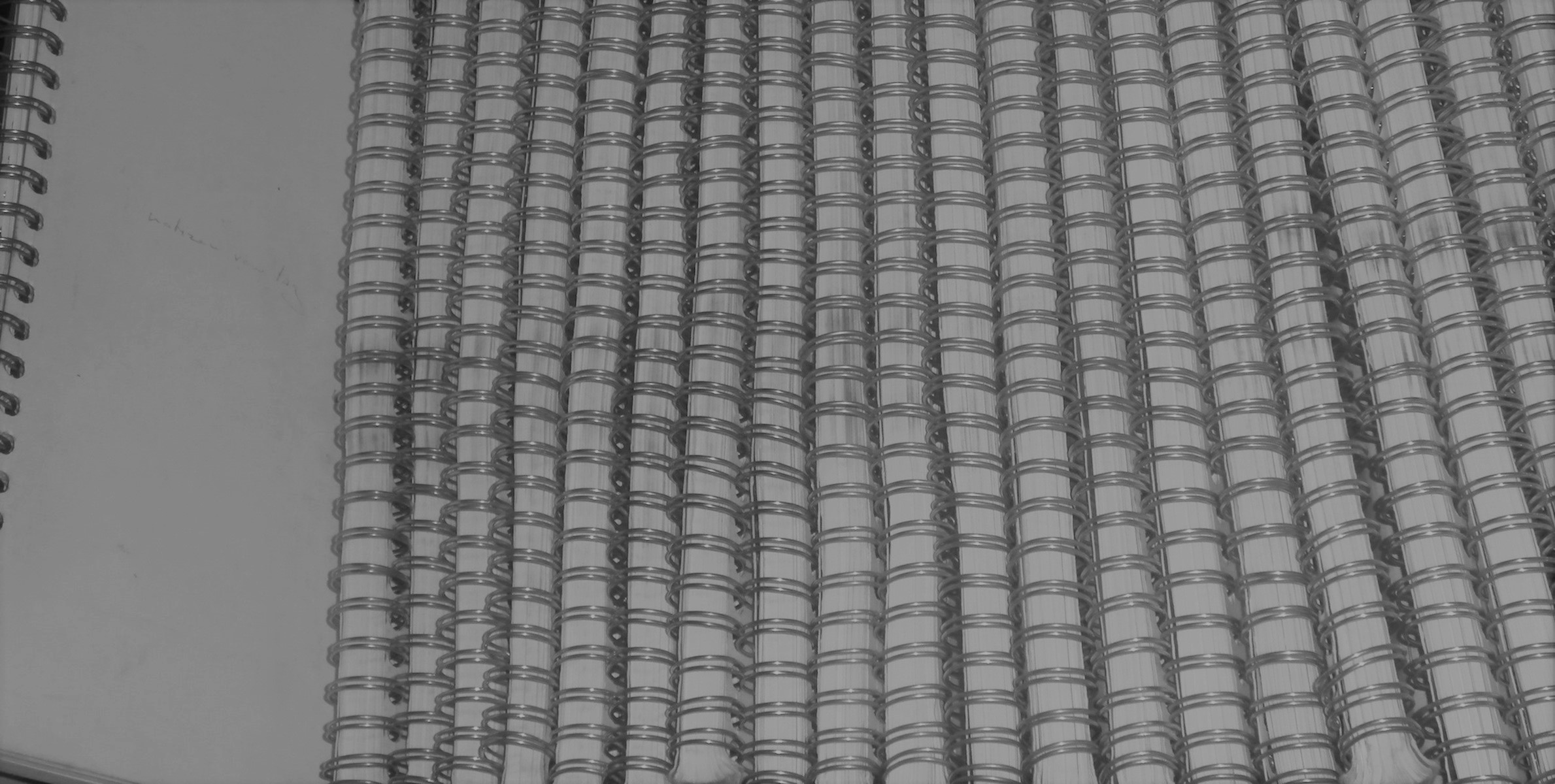Tagsätze.
Nacht- und Abendsätze.
Weinsätze.
und immer wieder neue Regensätze.
Regen Regen Regen.
wenn er sie sauber waschen könnte.
der Regen.
in tausenderlei Jahren.
Man darf auch Glück haben
Man darf auch Glück haben
steht auf der Postkarte.
sie glaubt es nicht.
unverstanden ungesehen
unverstanden ungesehen
die innere Wahrheit eine Lüge
ohne Spiegelung kein Innen
leer blieb die bessere Option.
Optionen. sie hat nie Optionen gehabt.
oder doch. sonst wär sie nicht hier.
nicht da nicht dort.
nirgends mehr
sie muss ein paar gute Entscheidungen
getroffen haben. für sich
für andere?
für andere weniger.
erst heute. für ihre Kinder.
kann sie Entscheidungen treffen, die
auch für andere gut sind.
leere Kugel
leere Kugel.
außen warm und innen kalt.
außen reich und faszinierend –
innen hohl und keins der Versprechen haltbar.
kuscheln endet in Kühle
Nähe in Distanz
die Männer haben es nie verstanden
die Frauen und Mädchen auch nicht.
sie wäre gern verstanden worden.
Eine Rolle rückwärts.
Eine Rolle rückwärts. Der kleine Junge strahlt und probiert es gleich nochmals. Er rollt über die rechte Schulter, sehr geschickt sieht das aus. Er lacht und rennt zum Opa, der zuschauen soll statt nur vor sich hin zu starren. Der Opa war lange im Gefängnis gewesen. Alle rund um den kleinen Jungen sagen, dass er unschuldig verurteilt worden war. Der kleine Junge glaubt ihnen das, er spürt doch, dass der Opa keinem was zuleide tun kann. Der ist lieb, wenn er ihn denn wieder rausziehen kann, aus diesem Gefängnisblick. Der kleine Junge nennt das den Gefängnisblick.
Oh, mein Enkel. Ja, ja, ich komme ja schon. Wie groß er schon ist. Ja, du hast ja recht, ich komme jetzt und schaue. Was sagst du? Eine Rolle rückwärts in der Luft? Du meinst einen Salto? Das darfst du noch nicht üben, das hat dir deine Mama doch verboten. Hab ich wieder zuwenig gut auf ihn aufgepasst. Wenn da was passiert wäre. Aha, er übt erst mal am Boden. Das ist mir lieber. Das gelingt ihm gut, der ist geschickt. Schön, ihm zuzuschauen. Mein Freund, in der Grundschule, der konnte in der dritten schon Salto aus dem Stand. So einer wird mein Enkel auch, glaube ich.
Sie hat Schmerzen.
Sie hat Schmerzen. Hinter den Augen, in der Stirn, in Armen und Beinen. Sie rennt, innerlich, und zittert. Sie sitzt auf einer Bank, am Spielplatz, und sieht den Kindern zu. Sie wirkt ruhig und entspannt. Friedlich. Die Leute setzen sich gerne zu ihr. Sie ist freundlich mit den Kindern, mit allen, den eigenen und den fremden. Keiner sieht, dass sie rennt. Und zittert. In ihren Muskeln. In ihrer Seele. Und außen freundlich. Welch ein Kraftakt. Sie schaut auf die Kinder, sieht ihrem Spielen zu. Und wundert sich, wie weit sie gekommen ist.
Er weint.
Er weint. Mit trockenen Augen. Um die Frau, die er geliebt hat. Die gegangen ist, ohne ein Wort. Kein Geschrei, das ihm alles erklären würde. Nur der Wind in den alten Tannen um das Haus. Ein Eichhörnchen. Ansonsten Stille. Sie hat ihre Sachen mitgenommen, also wird sie nicht ins Wasser gegangen sein. Aber weiß er es. Nein, er weiß es nicht. Er wartet, jeden Tag. Lauscht dem Wind, in den Tannen. Läuft durch den Forst zum Teich. Denkt jeden Tag, der ist zu klein. Und kann doch nicht anders, als die Wasseroberfläche, die Ufer absuchen, jeden Tag aufs Neue. Sie wollte leben, sie wollte sterben, beides gleichzeitig. Vielleicht ist es das, was sie in ihm gesehen hat, gespürt. Er hat nie verstanden, wieso sie so lange bei ihm geblieben ist. Er könnte ihr Vater sein, fast ihr Großvater. Sie hat sich gesehen gefühlt, verstanden, ohne viele Worte. Vielleicht war es dieses Sterben im Leben. Diese Sehnsüchte, in beide Richtungen. Ein Hunger, nach Leben. Ein Sattsein, so gründlich, dass man nicht mal mehr reden musste. Von den Tannen rieseln die Nadeln. Unten sind sie längst kahl. Viel zu dicht gepflanzt, ein typischer Forstwald, wie man ihn früher gepflanzt hatte. Da war sie noch gar nicht auf der Welt gewesen. So jung. Und so alt zugleich. Er hatte sich sofort in sie verliebt. So sehr wie nie zuvor in seinem Leben. So tief und so schmerzhaft, als hätte sie sich eingewurzelt, innen in ihm. Und immer wieder gezogen daran. Bis sie sich rausgerissen hatte. Nach sieben Jahren. Ohne Geschrei. Lautlos. Und gegangen war. Nur mit dem Wind in den Tannen, der geblieben ist, für ihn.
Acht Minuten.
Acht Minuten in dieser Stille. Sie hat sich eingeschlossen, im Keller, im Bunker. Die Luftschutztür war schwer zu verschließen gewesen. Aber nur dort war es endlich komplett still. Dicke Betonmauern, unter der Erde. Sie hätte nicht gedacht, dass sie das aushalten könnte. Sie hat ihren Bruder, auf der anderen Seite, mit dem Wecker. Nach genau acht Minuten wird er diese Tür wieder öffnen, er hat es versprochen, sie vertraut ihm. Und eingeschlossen in diesem unterirdischen Bunker fühlt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig frei. Kein Geräusch, was schmerzt, im Kopf. Auch keine Vögel, die mit ihrem Gezwitscher grelle Punkte vor ihre Augen malen. Keine Autos über Kopfsteinpflaster. Keine Kinderstimmen vom Spielplatz. / Er kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, unter allen Geräuschen zu leiden. Er liebt die Vogelstimmen, die Kinderschreie, sogar die Autos über Kopfsteinpflaster. Das Leben, mitten in der Stadt. Und nun hält er den Wecker in der Hand, acht Minuten, und schenkt seiner Schwester Stille.
Ich sitze in einem Sessel.
Ich sitze in einem Sessel. Ein dicker alter brauner Ohrensessel. Der Stoff ist speckig, mit Krümeln übersät und bedeckt von Katzenhaaren. In so etwas dreckiges wie diesen Ohrensessel würde ich mich nie hineinsetzen. Und nun hat er mich eingeladen. Weil ich ihm geholfen habe, mit seinen drei Tüten. Die Tüten waren zu schwer für ihn. Manchmal zieht Helfen Dinge nach sich, die ich nicht vorhergesehen habe. Nun sitze ich bei diesem alten Herrn im Wohnzimmer. Er hatte keinen Alkohol in seinen Beuteln, er schleppte Katzenfutter nach Hause und Katzenstreu. Vier sind es und streunen um meine Beine. Ich bin allergisch und niese, immer wieder, und kann doch nicht aufstehen und gehen. Er sitzt mir gegenüber, auf einem grünen Sofa mit Löwenfüßen, der Bezug genau so speckig wie in meinem Ohrensessel. Er sitzt da, streichelt seine Katzen und hört zu. Er hat nichts gefragt, ich sage nichts, und doch fühlt es sich so an, als würde er mir zuhören. Ohne ein einziges Wort. Meine Angst, die mich immer begleitet, bröckelt ab wie Kuchenkrümel. Eine weitere Schicht für den Sessel. Ich weiß nicht, wie lange ich bei ihm sitzen geblieben bin.
Es ist nicht alles schlimm.
Furchtbare Schmerzen. Der gesamte Unterleib. Die Oberschenkelinnenseiten. Nerven links. Das Becken wie überdehnt. Alles geschwollen.
Sie schreibt an ihr Tagebuch. Sonst gibt es keinen, der wissen will, wie es sich anfühlt. Wenn man sich zum ersten Mal erinnert, was die eigene Mutter gemacht. Mit Fingerspitzen. Und Fäusten.
Sie schreibt, dass sie wieder trinkt. Und nicht mehr schlafen kann. Dass sie Schmerzen hat und kaum noch laufen kann, geschweige denn sitzen. Als wäre es gestern gewesen.
Und ist sechzig Jahre her. Sie glaubt es selber kaum. Wer sollte sonst ihr glauben. Die Leute haben ja keine Ahnung.
Sie hat es aufgeschrieben. Damit sie nach einer Woche zwei nicht wieder tun kann, als wäre alles so ganz ohne.
Easy peasy.
Ist es nämlich nicht.
Sie geht jetzt ins Theater. Eine Freundin spielt. Ja, sie hat auch Freundinnen. Zwei. Und sie gehen ihr nicht mehr verloren.
Das Theater wird ihr helfen. Ablenkung. Und die Musik. Bis sie selber wieder Lust hat, zu singen.
Sie singt gern.
Auf dem Weg zum Theater blühen Robinien. Die weißen Blütentrauben. Der Duft.
Sie kann sehen. Sie kann riechen.
Es ist nicht alles schlimm.
Lange nicht alles.
Todesangst.
Sie spielt Verstecken. Mit ihrem Sohn. Fröhlich und ausgelassen. Er zählt an, sie rennt ins Kinderzimmer, versteckt sich unter der Decke. Er findet sie nicht. Lange nicht. Sie liegt still. Sie atmet kaum. Das Herz spielt verrückt. Wird schneller und schneller. Die Hitze unter der Decke. Die Atemnot. Sie kriegt keine Luft. Sie kann sich nicht rühren. Der Kleine reisst die Decke weg. Hab dich! Sie atmet wieder. Die Sicht bleibt verschwommen. Über Stunden. Sie kann nicht mehr spielen. Sie war seit vielen Jahren nicht mehr so nah gewesen. An dieser Todesangst. Mitten im Spiel.
Blauer Himmel.
Heute scheint die Sonne. Nach gefühlten Wochen mit kaum einem Fitzelchen Licht. Wie anders die Welt aussieht. Wie viel weiter weg die Sorgen rücken. Um Berufsverbote für ungeimpfte heilende und pflegende Menschen – Menschen, die wir so dringend brauchen. Wenn die Qualität der Arbeit keine Rolle mehr spielt, stattdessen der Impfstatus zählt. Und Menschen, die sich aus Überzeugung für die Impfung entschieden haben, oder weil sie dem Druck nicht stand gehalten haben, die nun die „besseren Menschen“ sind. Obwohl die meisten von ihnen gar nicht bessere Menschen sein wollten, sehr viele es immer noch nicht wollen. Und mit der Sonne sehe ich wieder die Christrosen blühen, in all den kleinen Baum-Umrandungs-Gärten in Berlin. Die Bäume recken ihre Äste in den Himmel und werden im nächsten Jahr wieder Blätter tragen. Mit der Sonne weiß ich es plötzlich wieder. Das Vertrauen ist zurück. Die Blätter und Blüten werden wiederkommen. Ganz unabhängig von den Entscheidungen rund um diese eine Krankheit. Es gibt so viele andere Entscheidungen, die warten. Und Tage, die einfach gelebt werden können. Ohne Entscheidung. Keiner von uns sollte besser oder schlechter sein. Ich wünsche mir, dass wir alle Menschen bleiben, mit Achtung und Wertschätzung für unterschiedliche Wege. Mit gemeinsamen Gesprächen, sonnigen Augenblicken unter blauem Himmel.
Gestorben.
Er ist gerne bei ihr gesessen. Der Alltag wurde still und ruhig neben ihrem Bett. Die wenigen Worte. Die Geräusche vom Luftbefeuchter und vom Sauerstoffgerät. Manchmal ein Vogel von draußen, dann hat sie noch den Kopf bewegt. Für ihn musste sie sich nicht bewegen. Sie lag ganz still, die Augen geschlossen. Aber sobald er da in seinem Sessel saß, als könnte sie ihn spüren, hat sie jeweils für einen kurzen Moment diese tiefen klaren blauen Augen geöffnet. Nur für ihn. Er wusste dann, dass sie noch hier war. Was immer das noch bedeutete, hier, nicht dort, nicht drüben. Und er schaukelte vor und zurück, in ihrem Sessel, sachte, nicht unruhig. Seine Unruhe fiel von ihm ab, sobald er ihre Wohnung betrat. Diese Nähe zum Tod, die machte ihn ruhig. Das gefiel ihm. Als sie noch mehr hatte sprechen können, hatte er auf ihre Frage, ob es nicht belastend wäre für ihn, neben einer Sterbenden zu sitzen, erklärt, er hätte den Tod so oft so nahe gesehen, in seiner schrecklichen Kindheit, dass ihn Sterben nicht mehr schrecken könnte. Aber je mehr Tage er jetzt in Stille neben ihrem Bett saß, desto falscher kam ihm diese Erklärung vor. Er hatte oft Angst gehabt, damals, gleich wäre es vorbei. Er hatte oft gehofft auch, es wäre endlich vorbei. Und dennoch. Er war noch nie so nah am Tod gewesen wie jetzt, in diesem Zimmer. So nah an dieser Öffnung, zwischen den Räumen. Als könnte er selber mit hindurchschlüpfen. Hin und zurück. In dieser Stille. Nun sitzt er ein letztes Mal am Bett. Es ist stiller noch als sonst, kein Luftbefeuchter, kein Sauerstoffgerät. Nur Stille. Und die Öffnung ist zu. Sie hat sich geschlossen, hinter ihr. Er kann nicht mehr mit, vor und zurück, tastend, suchend, fragend. Er sitzt allein. Im Leben. Und beneidet sie ein wenig. Aber nur kurz. Sie kann ja auch nicht mehr zurück. Und er mag sein Leben.
Sie erwähnt ihr Kind.
Sie erwähnt ihr Kind. Sie hat es nie gekriegt. Sie hat es abgetrieben. Aus guten Gründen. Sie hat es vermisst. Jahrzehntelang. Sie hat sich nicht getraut zu trauern. Sie wollte es ja nicht. Oder doch? Oder nicht. Sie konnte sich nicht entscheiden. Sie hat sich entschieden. Trauern lag nicht drin. Jetzt sind es ein paar Wochen noch. Der Arzt ist nicht mehr optimistisch. Er schlägt keine neue Therapie mehr vor. Er schreitet Richtung palliativ. Und sie? Zum ersten Mal in ihrem Leben beginnt sie zu trauern. Um ihr Kind. Das nicht groß geworden ist. Das nicht geboren wurde. Das fehlt. Immer gefehlt hat. Sie weint. Am Küchentisch. Keine großen Tränen. Stille, kleine Tränen. Ein Glück, dass es einmal noch da sein darf. Ausgesprochen. Auf den Tisch gelegt, das kleine Bündel. In Tücher gewickelt. Gewiegt und gehätschelt. Der Tisch ist leer. Ihr Gesicht wird still und ruhig. Als wäre sie bereit, einen weiteren Schritt zu gehen. In die Richtung dorthin, wo ihr Kind, vielleicht, bereits ist.
ich habe sie losgelassen.
ich habe sie losgelassen. wohin? ich weiß es nicht. bin ich traurig? ja. bin ich schuldig? ja. bin ich froh? manchmal. bin ich unschuldig? selten.
Ich bin draußen.
Ich bin draußen. Ich bin tatsächlich draußen. Ich habe es geschafft. Sie schaute sich um, in dieser neuen Welt. Es war nur diese eine Tür zwischen dieser Welt und der vorherigen. Aber sie hatte sie aufgemacht. Schön, dass ihr alle an mich gedacht habt. Schön, dass ihr alle mich gerne dabei haben möchtet. Und ich muss mich leider verabschieden. In zwei drei Monaten dürft ihr mich gerne wieder fragen. Vielleicht werde ich mich freuen. Heute winke ich in die Runde. Nein, ich werde mich auch nicht allen einzeln erklären. Ich werde mich gar nicht erklären. Ich werde auch nicht alle einzeln umarmen, mich nicht küssen lassen von Menschen, die ich selber gerade nicht küssen möchte. Ich winke und gehe. Ich nehme diese Türklinke in die Hand und drücke sie runter, obwohl die Party gerade erst angefangen hat. Ich öffne die Tür und schiebe mich hinaus, als hätte ich hinter mir noch ein zweites Mal Hände und Arme, richtig starke Arme, die mich aus der Tür schieben und mich stützen. Sie schaute sich um, und ja, die Welt sah aus wie neu. Sie war farbig, obwohl bereits die Dämmerung eingesetzt hatte. Sie sah die Blumen auf dem Fenstersims der Kneipe und die Katze unter dem Auto der zweiten Reihe, obwohl in der Großstadt kaum freilaufende Katzen unterwegs waren, jedenfalls nicht hier, mitten drin, vielleicht am Rand. Als wäre sie mehr an den Rand gerückt, mit dieser einen Tür. An den Stadtrand. An den Menschenrand. An den Rand der Welt der Tiere. Und an den Anfang ihrer eigenen Welt. Die farbig sein konnte. Wenn sie nur die Kraft hatte, sich hineinzubegeben. Ein paar Tage. Ein paar Wochen. Ein paar Monate. Sie wusste es noch nicht zu sagen. Aber es war mal wieder an der Zeit, der Außenwelt Adieu zu sagen und sich nach innen zu wenden. Jetzt, wo sie tatsächlich draußen auf der Straße in der Kälte stand, begann sie, sich darauf zu freuen.
Der Blick verschwimmt.
Der Blick verschwimmt, die Spannung nimmt ab. Es ist nicht gut, aber auch nicht schlimm. Er trinkt, er will nicht trinken. Er trinkt, das tut ihm gut. Er weiß, dass es ihm nicht gut tut. Es tut ihm trotzdem gut. Es nimmt die Spannung. Es nimmt den scharfen bösen Schmerz. Und es lässt ihn schlafen. Irgendwann. Wenn er müde genug ist.
Der Blick verschwimmt, er schenkt sich nach. Er sitzt allein am Tisch, er trinkt mit sich allein. Er will nicht mehr trinken. Er nimmt es sich vor, jeden Tag, wenn die Spannung noch nicht so hoch ist. Aber bis zum Abend hin, erst recht, seit es wieder so früh dunkel wird, sind die Schmerzen so stark, dass er lieber trinkt.
Ärzte mag er nicht mehr sehen. Ihre Ratschläge haben noch nie nichts gebracht. Er könnte spucken. Mit ordentlich gesammelter Spucke. Wenn er es sich richtig überlegt, solche Ärzte, die von nichts eine Ahnung haben und dennoch so tun, als wüssten sie alles über ihn und von ihm und in ihm und überhaupt, die kann man gar nicht unangespuckt lassen.
Er kann wütend werden. So richtig wütend. Und das ist gefährlich. Also bleibt er an seinem Küchentisch. Am Küchentisch ist er in Sicherheit. Er gießt sich nochmals nach. Ein letztes Mal. Langsam gibt es Menschen, in seinem Leben. Auch einzelne hilfreiche Menschen, so scheint es ihm. Vielleicht ist ihm ja doch noch zu helfen.
Wünschen tut er sich die Hilfe nicht. Das ist lange her, seit er zum letzten Mal diese Sehnsucht gespürt hat, dass ihm doch jemand helfen möge. Als Teenager vielleicht. Und früher, als Kind. Aber da hatte keiner geholfen. Es sah doch alles super aus. Wer sollte da auch einschreiten. So war das leider. Er hat das seither schon oft gesehen.
Aber jetzt ist einer da, dem er wirklich am Herzen zu liegen scheint. Was immer das bedeuten mag. Es ist so neu, dass er manchmal gerade deswegen extra viel trinken muss, abends, nachts, allein am Küchentisch. Und dennoch fühlt es sich nach Hoffnung an. Und Hoffnung, das hat er lange nicht mehr gespürt.
Er verschließt die Flasche, Whiskey, vom feineren. Vom feinen Wasser gibt es weniger Kater. Er geht auf den Balkon, sagt den Sternen gute Nacht. Das macht er jeden Abend, seit es den andern gibt. Die Sterne winken zurück.
Und dann ist er wieder aufgestanden.
Und dann ist er wieder aufgestanden. Draußen schien die Sonne. Er hat sich gezwungen, seine Schuhe anzuziehen, die Jacke, und nach draußen zu gehen, in den nahe gelegenen Park. Um diese Uhrzeit war der Park meistens fast leer, da konnte er sich gut bewegen, mit wenig Angst, und das war schon viel. Und im Park lagen die Blätter, die farbigen. Die roten gelben violettgrünen braunen. Er wirbelte sie durcheinander, mit seinen Füßen. Er hatte ein Lachen im Gesicht, kurz, wie ein kleiner Junge. Mit den Händen fischte er ein Blatt aus der Luft, steckte es sich in den Mund. Ein Geschmack nach Grün, nach Erde, nach Dung. Er lachte laut auf, versteckte verschämt sein Gesicht in den Armen, sah sich nach allen Seiten um, aber da war keiner, keiner hatte ihn gesehen, keiner ihn gehört. Da schob er einen Laubhaufen zusammen, mit Händen und Füßen, und setzte sich mitten hinein. Wie früher. Ganz früher. Wie lange war das her? Irgendwie fühlte er sich ernährt, als hätte er einen warmen Porridge gekocht gekriegt, von Großmutter, mit ein bisschen Zucker und Zimt, mit einem Stück geschmolzener Schokolade eingerührt. Er legte sich hin, mitten in die Blätter, und starrte in die Bäume hinauf. In den blauen Himmel, die ziehenden Wolken, die Sonne in den Ästen. Da wurde es plötzlich laut. Eine Horde Gänse. Ein Schwarm. In Formation flogen sie über seinen winzigen Park, mitten in der Stadt. Er lachte glücklich. Und sah den Gänsen lange hinterher.
Der Zug war abgefahren.
Nochmal studieren? Er scrollte durch die Seiten, las hier einen Absatz, dort einen, klickte weiter zum nächsten Studiengang. Aber in seiner Lage, mit seinen Einschränkungen, war vieles nicht mehr möglich. Im sozialen Bereich, der ihn interessierte, gab es keine reinen online-Studiengänge. Überall waren gewisse Module in Präsenz, praktische Inhalte und Angebote in Gruppen. Und das konnte er nicht. Vielleicht in ein paar Jahren, aber wer konnte das wissen? Jetzt, im Moment, wagte er nicht zu glauben, dass er je wieder unter mehr als zwei drei Menschen sich würde aufhalten können. Geschweige denn, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, durch ein Bahnhofsgebäude ins Freie zu kommen, in einem fremden Hotel zu übernachten und in größeren Studierendengruppen seine Scheine zu machen. Er gab es auf. Der Zug war abgefahren. Entmutigt klappte er den Laptop wieder zu. Wieviel Schwung hatte ihm der Gedanke gegeben, vielleicht doch nochmal zu studieren. Jetzt war der Schwung schon wieder weg. Er verkroch sich ins Bett, unter die Decke. Am liebsten hätte er geheult.
Der Zug.
An diesem Abend ging sie spät noch zum Zug. Sie wollte das Ticket schon mal kaufen, damit sie am nächsten Tag nicht in Stress kommen würde, mit der kleinen Tochter und dem Gepäck. Ein Ticket zu Freunden aufs Land. Stattdessen löste sie eine Bahnkarte nach Paris. Und von Paris weiter nach Toulouse. Von Toulouse weiter nach Portecluse, ein Hof und eine Schule mitten im Nichts, sie hatte kaum Erinnerungen daran. Aber an diesem Abend war der Hof plötzlich wieder da. Das große Tor, die alten Bäume, der Brunnen. Der hinkende Hund, den es natürlich schon lange nicht mehr geben würde, aber anders konnte sie sich den Hof gar nicht vorstellen. Die kleine Schule, die ihr so wunderbar vorgekommen war, weil sie plötzlich sein durfte wie sie war, ohne sich mehr ständig zu erklären. Der Martin hatte sie unter seine Fittiche genommen, Flügel rechts und links, ein großer Engel, ohne Sex. Der Martin hatte sie von der Straße geholt und nach Portecluse gebracht. Inkognito. Sie war tatsächlich ab dem Moment in Sicherheit gewesen, in dem sich das Hoftor hinter ihr geschlossen hatte, obwohl es sich in ihr noch jahrelang, jahrzehntelang nach Gefahr angefühlt hatte. Eigentlich hatte sich das nie so ganz aufgelöst, auch nicht nachdem sie schon lange in Berlin lebte, weit weg von allem. Und an diesem Abend, nach der langen online-Konferenz, wollte sie zum Bahnhof spazieren, frische Luft schnappen und ein Ticket lösen, um am nächsten Tag für die Reise mit ihrem Kind weniger Stress zu haben. Auf dem Weg zum Zug war sie in diesen großen dunklen Mantel hineingelaufen. Der Mann kam ganz nah an der Mauer um die Ecke, auf dem schmalen Übergang, der zu den Gleisen führte. Ganz plötzlich waren diese schwarzen Mantelflügel rings um ihren Körper, dieser übergroße Mann mit den stolpernden Beinen zwischen ihren, schon halb über ihr, und der Gestank, nach Schweiß, nach Rauch, nach Alkohol. Sie kotzte dem Mann vor die Füße, statt sich zu bedanken, dass er ihr aufgeholfen hatte. Sie entschuldigte sich nicht, schließlich war sie rechts gegangen, ganz so, wie es üblich war, in Berlin. Und das Kotzen, dafür konnte sie sich erst recht nicht entschuldigen. Es kam so unvermittelt, dass sie selber nur staunend hinterherschauen konnte. Sie hatte weder gegessen noch war ihr schlecht gewesen, als sie vom Computer aufgestanden und zum Bahnhof gelaufen war. Statt zum Automaten zu gehen und ein Ticket für die äußerste Ecke Brandenburgs zu lösen, folgte sie dem Geschmack im Mund zum Reisezentrum der deutschen Bahn und kaufte sich eine Karte nach Paris. In Paris stieg sie am frühen Morgen um, nach Toulouse. In Toulouse sah sie sich nicht um, ging in keine einzige Straße, hob jede Menge Euros ab am Geldautomaten neben dem Gleis, stellte sich vor den Bahnhof und leistete sich eine Taxifahrt aufs Land. Unbezahlbar. Unglaublich teuer. Heutzutage konnte sie sich das leisten. Auch wenn sie nicht an ihr Kind denken durfte. Mit ihr hätte sie doch heute aufs Land fahren wollen. Sie hatte nicht mal ihr Handy mit. Wie lange sie bleiben wollte, wusste sie noch nicht. Sie musste erst mal den Hof finden, die Schule. Vielleicht den Martin, falls er nicht längst gestorben war. Und dann würde sie weiter sehen. Vielleicht konnte ja alles wieder gut werden. Sie hatte doch jetzt ihren Mann und ihr Kind. Sie war doch schon so lange weit weg.
Mein Dream.
Mein Dream. So sagt man heutzutage. Er träumt auch, manchmal. Er möchte gerne, dass ihn alle verstehen würden. Oder wenigstens die paar wenigen Menschen, die es rund um ihn noch so einigermaßen ausgehalten haben, bisher. Wenn zwei oder drei übrig bleiben könnten, die ihn wirklich verstehen, ohne dass er sich immer lange erklären muss. Das wäre schön. Fast ein Dream.
Voll geil.
„Voll geil, ich hab da mega Bock drauf, das ist voll mein Dream!“ Sie war an einem Café stehen geblieben. Zwei Frauen saßen an einem winzigen Tisch auf kleinen farbigen Stühlen. Vegan und regional wurde gekocht, die Speisen sahen lecker aus, sie überlegte, sich vielleicht zu setzen. Da sprang dieser Satz sie an: „Voll geil, ich hab da mega Bock drauf, das ist voll mein Dream!“ Und sie beeilte sich, wegzukommen von den kleinen Tischen, den bunten Tellern, den veganen Speisen. Weg von der Stimme, die sich eingebrannt hatte in ihren Kopf, sofort, ungefragt. Sie kannte diese Stimme. So hatte früher ihre Schwester gesprochen. Mit dieser überhöhten Begeisterung, dieser übertriebenen Betonung. Nur mit anderen Worten. Ihre Schwester hätte solche Worte nie in den Mund genommen. Aber das hatten sie alle nicht getan. Damals. Sie hatte keine Ahnung, wovon die beiden jungen Frauen gesprochen hatten. Sie wusste nur, dass sie keine Sekunde länger in deren Nähe bleiben durfte, dass sie keinen einzigen weiteren Satz mehr hören wollte. Und dass sie diese Art der Sprache nicht mehr verstand.
Offline.
Sommer. Ich werde wieder offline gehen. Nicht so lange am Stück wie in anderen Jahren. Aber immerhin. Irgendwo in mir die Hoffnung, dass dann auch die Texte zurückkehren, wie im letzten Jahr. Die langen Texte, die großen Projekte. Unterwegs, im Wald, am See, am Strand. Abends, wenn alle schlafen. Perspektivenwechsel, nicht mehr Berlin. Die Hoffnung des Waldes, der Bäume. Sonne und Regen. Ein Stückchen Freiheit.
Die Leere.
Plötzlich sind alle weg. Die Kinder ausgeflogen. Der Mann verreist. Die ersehnte Zeit allein zuhause. Mit nichts als mir. Und die Leere schlägt zu. Mit Gefühlen, die alles andere als angenehm sind. Oder mit einem Mangel an Gefühlen, einer Dumpfheit im Kopf. Einem Überdruck an Gefühl, der sich nicht als Gefühl mehr erklären lässt. Bestimmungsbücher, wie für die Pflanzen, Botanikunterricht. Aber die Gefühle lassen sich nicht bestimmen, nicht trennen, nicht aufdröseln. Ein Druck im Körper, eine Leere im Kopf, Gelüste nach Alkohol und Zucker. So schön ist es nicht, endlich mal wieder Zeit allein zu haben. So sehr ich mich danach gesehnt habe. Der Anfang ist immer so. Unangenehm. Wenn ich nicht wüsste, dass es mit der Zeit leichter wird, irgendwann jeweils sogar schön, dann würde ich gleich aufgeben, hinterherreisen, mich in Aktivitäten stürzen. Aber was ich brauche, ist erstmal Ruhe. Ruhe und Schlaf. Ein paar Zeilen schreiben. Tee trinken auf dem Balkon. Wieder schlafen. Weitere Zeilen schreiben. Einen leckeren Salatteller essen, nicht Kekse, stattdessen viele Farben mischen, ein bisschen Essig, ein bisschen Öl, ein paar Nüsse. Geschmackserlebnisse. Frische. Ein Glas Wasser. Und wieder schlafen gehen. Ich glaube, ich könnte stundenlang schlafen. Auch mitten am Tag. Vielleicht ist es genau das, was ich mir dieses Mal gönne. Tatsächlich schlafen zu gehen, statt das nächste Buch zu lesen, oder doch plötzlich wieder zu arbeiten. Nein, Pause. Ich habe eine Pause verdient. Ich werde schlafen, soviel ich schlafen kann. Lecker essen. Tee trinken. Schreiben. Und wieder schlafen.
Und immer wieder der Weg ins Netz.
Und immer wieder der Weg ins Netz. Ein kleines Unbehagen, ein bisschen Hunger, keinen Freund, kein Kind, keinen Nachbarn. Die Alternative heisst Netz. Den Laptop öffnen, ausgeschaltet ist er nie, Passwort eingeben, schon geht es los. Nachrichtenseiten. Links zu weiteren Nachrichtenseiten. Weitere Links zu schon mehr Boulevard, Voyeurismus. Oft geht es um Kinder, Missbrauch, Porno, Vergewaltigungen. Verhaftungen, Prozesse, die niedrigen Strafmaße. Die Sätze der Verteidiger, die ihre Mandanten raushauen. Mit Anrechnung der Untersuchungshaft und Bewährung und gutes Betragen. Bis zwei Monate bleiben, oder zwei Wochen, die noch abzusitzen sind. Und wieder auf freiem Fuß. Und weiter so. Manchmal will er es nicht mehr hören. Und liest trotzdem weiter. Klickt sich von Seite zu Seite. Unterschreibt die Petitionen zur Verbesserung des Opferschutzes in Deutschland. Verirrt sich auf die Seite des ermordeten Stalking-Opfers ebenso wie auf die Unterstützerseite für Frau Bacot, die ihren Täter-“Ehemann“ nach Jahrzehnten des Leidens erschossen hat. Erstmals seit langem ein Freispruch, den er voll und ganz verstehen kann, für den er sich sogar eingesetzt hat mit seiner Unterschrift. Manchmal hat er das Gefühl, etwas zu verändern in dieser Welt, mit Unterschriften unter irgendwelche Petitionen. Obwohl er weiß, dass er längst gar nichts mehr tut, seit vielen Jahren, seit er sich mehr im Netz bewegt als im realen Leben. Das reale Leben kommt ihm bereits bedrohlich vor. Sich hinaustrauen, unter Menschen, nicht wissen, was sagen, wie lächeln oder nicht lächeln, hinterhersehen oder nicht. Da bleibt er lieber zuhause. Seit er Geld vom Amt kriegt, gibt es keine Gründe mehr, vor die Tür zu gehen. Und um nicht selber auf den einschlägigen Seiten zu landen, liest er alle Berichterstattung rund um die einschlägigen Themen. Und unterschreibt Petitionen. Und fühlt sich besser. Als hätte sein Leben doch einen kleinen, klitzekleinen Sinn.
Sie spürte sie nicht mehr.
Sie spürte sie nicht mehr. Die Liebe zu ihrem Kind. Sie hatte die Rituale, an denen hielt sie sich fest. Streichelte ihn in den Schlaf. Flüsterte ihm ins Ohr, wiesehr sie ihn lieb hatte, wiesehr sie ihn immer immer beschützen würde, wiesehr er eine gute Nacht haben sollte. Hielt ihre Hände an seinen Rücken, seinen Nacken, bis er nicht mehr zuckte, bis er tief und fest eingeschlafen war. Dann stand sie wieder auf, setzte sich an den Küchentisch und begann zu trinken. Nicht übermäßig. Aber kontinuierlich. Ohne zu schlafen. Gegen vier hörte sie auf, um morgens nicht mehr nach Alkohol zu riechen, für das Kind. Sie holte den Wäschekorb und begann, die liegengebliebenen Klamotten in die Waschmaschine zu stopfen, die sauberen vom Ständer zu nehmen, um später die nassen gleich wieder aufhängen zu können. Alles in einem Arbeitsgang, langsam, mit leicht verwaschenen Bewegungen, aber koordiniert, eigentlich unauffällig, wie sie fand. Während die Maschine schleuderte, wärmte sie sich die Nudeln vom Vorabend. Sie hatte abends nicht essen können. Wie meistens. Morgens um fünf ging es dann, oder musste, weil nur ein gefüllter Magen verhinderte, dass sie doch um sieben noch nach Alkohol roch, wenn der Kleine wieder aufstand. Nudeln essen. Zähneputzen, gurgeln, Pastillen lutschen, starke, scharfe. Wäsche aufhängen, danach duschen, Haare waschen. Rituale. Auch das. Wie oft hatte sie sich nicht geduscht. Aber die Frau hatte ihr gedroht, ganz freundlich, aber sehr gefährlich. Wenn sie nicht regelmäßig geduscht und ohne Alkoholfahne ihr Kind in die Kita brachte, würde sie eine Meldung schreiben. Und das, das konnte sie nicht gebrauchen. Sie konnte die Liebe zwar nicht fühlen, zurzeit. Aber sie war da. Ganz tief in ihr drin. Sie wusste das. Sie liebte ihr Kind. Und sie wollte es nicht verlieren.
Gefangen im Netz.
Aha. So war das. Mit Zwölfjährigen. Und eigentlich waren es Schauspielerinnen, erwachsene Frauen. Die wussten, worauf sie sich einließen. Die es dennoch kaum verkraftet haben. Und alle haben zusehen lassen. Im Film. Wie das funktioniert. Wie rasend schnell die Zwölfjährigen, die Mädchen, Kinder noch, erpressbar wurden und immer weiter hineinschlitterten. Ohne Wege, sich noch jemandem anzuvertrauen. Sie hatte verstanden. Vielleicht zum ersten Mal. Wenn diese zwölfjährigen Mädchen – wie hätte sie selber, als Kindergartenkind, als Grundschulkind, sich sollen wehren können. Oder sich offenbaren. Ja, wie.
(der Link zur Webseite des Films, Gefangen im Netz. Achtung, Triggerwarnung!)
Sonnenaufgang
Sie hatte in ihrer Wohnung, in der sie seit fünf Jahren wohnte, noch nie den Sonnenaufgang gesehen. Jedenfalls nicht im Sommer. Nicht bewusst. Sie war noch nie so früh auf den Balkon gegangen wie an jenem Tag. Sie war aufgewacht, mitten in der Nacht, wie meistens, aber dann hatte sie nicht wieder einschlafen können. Und hatte sich auch nicht an ihren Schreibtisch gesetzt, wie in vielen anderen Nächten. Sie hatte sich eine Kanne Tee gekocht und sich auf den Balkon gesetzt. Ohne Laptop, ohne ein Buch, es war noch dunkel gewesen. Eine Tasse nach der anderen hatte sie ihre Kanne ausgetrunken, schluckweise, ohne zu denken. Müde und doch nicht müde. Überwach und doch nicht wach. Nicht fit. Nicht gesund. Sie hätte es sich anders gewünscht. Aber sie saß auf diesem Balkon mit nichts in den Händen und nichts im Kopf. Leere. Und Stimmen. Alte und neue Stimmen, wild durcheinander. Denen sie nicht mal zuhören musste. Es blieb leer in ihr. Weswegen sie begann, den Himmel wahrzunehmen. Durch die Stimmen hindurch. Die heller werdenden Wolken. Die ersten gelben Wolkenränder. Die erste Helligkeit, die in ihren seit Jahren übernächtigten Augen blendete. Die Vogelstimmen, der Duft der Linde, den sie nicht riechen konnte, weil sie seit vielen Jahren nichts mehr roch, den sie dennoch wahrnahm, durch die Haut hindurch, weil die Augen die tausenden von Lindenblüten im riesigen Lindenbaum sahen. Uralt. Nicht sie, der Baum. Sie auch. Uralt. Mit Stimmen von allen in ihr. Im Kopf, im Körper, im Gesäß. Wie sie auf Gesäß kam? Sie hätte es nicht erklären können. Sie wollte sich auch gar nicht erklären. Keinem mehr. Sie war dankbar um die Schlafmedikation, die der Hausarzt ihr immer mal wieder verschrieb. Sie ging sparsam damit um, nur von Zeit zu Zeit mal eine Nacht mit ein paar mehr Stunden an Schlaf, dann konnte sie wieder weitermachen. Die Wolkenränder wurden so hell, dass sie nicht mehr in die Richtung schauen konnte. Und froh war, dass die Sonne hinter der Linde aufging, über dem Dach der Nachbarhäuser, des Nachbarblocks, ein großer grauer Riegel, mitten in der Landschaft. Sie hasste die Blocks. Etwas anderes konnte sie sich nicht mehr leisten. Seit sie berentet war. Mit fünfunddreissig. Die Leute verstanden das nicht. Sie auch nicht. Es gab keine Erklärung. Vielleicht wusste ihr Kopf etwas. Oder ihr Gesäß. Sie selber saß in aller Leere auf dem Balkon. Blieb sitzen, auch lange nach Sonnenaufgang. Die Linde warf angenehm grünen Schatten.
lesen. schreiben.
Mir ist deutlich geworden, wie ich lese. Dass es vielleicht anders ist als bei vielen anderen. Ich stelle mir die Figuren und Gesichter nicht vor in dem Sinne, dass ich sie vor mir sehe, vor meinem inneren Auge, als ein Bild zum Sehen. Ich fühle sie vielmehr in meinem eigenen Körper.
So schreibe ich vielleicht auch – was meine Texte für manche wunderbar und für andere unerträglich furchtbar macht.
Vielleicht.
da ich morgens und moosgrün. Ein Dankesbrief.
Mit „Und ich schüttelte einen Liebling“ begann meine Liebe zur Sprache von Friederike Mayröcker. Viele ihrer Bücher stehen bei uns im Regal. Frühmorgens, bevor die Kinder aufwachen, gönne ich mir zurzeit auf dem Balkon in der Morgensonne jeweils ein paar Seiten von „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“. Ein Buch, das mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt hat, im Frühjahr, Apfelblütenzeit.
Sechsundneunzig Jahre alt ist sie geworden, geschrieben hat sie bis in ihre letzten Tage. Dann bleiben mir noch fünfzig Jahre. Jeden Tag ein paar Zeilen. Ich möchte mich bedanken. Die Mayröcker, die Bachmann, beide haben sie mich und meine Sprache mit geprägt, verändert, bestärkt, immer wieder, über viele Jahre. Die eine ist alt geworden, die andere jung gestorben. Die Mayröcker hat mir einmal ein Buch signiert, die Bachmann hätte ich gerne kennen gelernt. Die Bilder von den Räumen voller Zettel und Bücher haben mir immer gefallen, auch zu Zeiten, als ich aus zwei Rucksäcken lebte. Langsam gehört mir ein bisschen mehr Platz für Notizbücher, Bücher, Zettel, Traumnotizen. Ganz so wild und reich wie Mayröckers Arbeitsplatz sieht es noch lange nicht aus.
Als Kind musste ich Dankesbriefe schreiben, unter Aufsicht, für jedes Geschenk, ob es mich gefreut hatte oder nicht. Heute schreibe ich aus mir selber heraus. Einen Dankesbrief. Für die Mayröcker. Vielen Dank für die Freiheit Ihrer Sprache, für die Radikalität der Dichtung, für die Hartnäckigkeit, mit der Sie bei der Ihnen ganz eigenen Sprache geblieben sind, sie immer weiter bewegt haben. Vielen Dank dass ich Sie lesen durfte, durch Ihre vielen Bücher hindurch, und die Welt durch Ihre Sprache.
Ein altes Haus.
In der Nacht, im Traum, war Anna bei einer alten Frau gewesen, die ihr Haus verkaufen wollte. Sie hatte ihre Eltern erwähnt, im Traum, und deren Geld. Wie präsent sie waren, diese Eltern, nachts. Obwohl sie kaum noch vorkamen, in ihrem Leben. Ob sie wohl mitlasen, in ihren Texten? Sie nahm es nicht an. Ihr Vater hatte es geschafft, ihr erstes Buch zu ignorieren. Die Mutter war so entsetzt gewesen, dass sie wohl lange Jahre nichts mehr lesen würde. Der Anna konnte es recht sein. Obwohl sie heisse Tränen weinte über Buch- und Filmszenen, wenn erwachsene Kinder bei ihren toten Eltern auf dem Dachboden ganze Kisten fanden mit Kunsterzeugnissen und Zeitungsartikeln und Erfolgen der Kinder. In ihrer Familie, da war das anders. Sie erinnerte sich noch genau, nach ihrem ersten Platz beim Jugendsolistenwettbewerb, wie der Großvater zu ihr gekommen war, nicht um zu gratulieren, sondern um in ernster und großer Sorge zu fragen: du willst doch nicht etwa Musikerin werden? Schriftstellerin war nicht viel besser. Vielleicht noch schlimmer. Mit Texten konnte man Dinge ausplaudern. Da wäre die Musik sogar weniger gefährlich gewesen.
Gefährlich.
Sophia sitzt an der Spree. In der Sonne. Der Mann ist ihr plötzlich unangenehm. Und gefährlich. Sie fühlt sich nicht mehr sicher.
Auch hinter schwarzen Sonnenbrillen sind die Blicke von manchen Männern unangenehm. Als würden sie direkt in die Scheide gehen.
Sophia flieht.
Geträumt.
Sie hat zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder davon geträumt, vor den Abitur-Prüfungen zu stehen und weder Latein noch Mathe noch Französisch irgendwie vorbereitet zu haben. Ein Traum, der früher über viele Jahre sehr regelmäßig wiedergekehrt ist. Aber zum ersten Mal hat sie diese Nacht im Traum gedacht, sie könnte auch einfach nicht an diese Prüfung gehen. In den früheren Träumen schien es immer ausweglos. Auch Träume können sich verändern. So wie irgendwann Farben aufgetaucht sind, während ihre Träume früher nur grau gewesen waren. Manchmal träumt sie jetzt sogar gerne.
Die Knospen öffnen sich.
Die Knospen öffnen sich. Erste Schleier von Grün vor dem Fenster. Bald werden die Häuser verdeckt sein. Ich freue mich darauf. Wieder nur Bäume und Himmel vor dem Schreibtisch, mitten in Berlin. Ich genieße meine Aussicht, einmal quer über den Fußballplatz, eine Weite fast wie auf dem Dorf. Die Bälle gegen das Gitter, die Stimmen der Kinder vormittags, die Schreie der Jugendlichen nachmittags, abends das raue Gebrüll der Männer, Fußball bis spät in den Abend hinein, schon bald wieder bis weit in die Nacht. Dorfplatz, Gruppen von Menschen, die gemeinsam lachen, gemeinsam essen, gemeinsam klagen, ein wenig als gäbe es Corona nicht, ringsum. Mir tut der Platz gut, die Geräusche, das Leben, die Freiheit des Blicks aus meinem Fenster, vom Schreibtisch, der Himmel, die Wolken, die Sonne.
Hoffnung.
Sie ist durch die Straßen gelaufen. Die hellen frischen Buchenblätter. Der Geruch. Die frische Luft. Bis zu den Gärten, durch die schmalen Wege. Kirschbäume in Blüte. Apfelbäume in Blüte. Weiß. Weiß mit rosa. Ein Meer von Blüten. Dazwischen die Magnolien, weiß, und rosa. Riesige Blüten. Fremdartige Blüten. Sie hat die Blüten getrunken, mit ihren Augen. Sie hat die Luft gerochen, auf ihrer Haut. Sie hat die Blätter ertastet, die winzigen, zarten. Sie hat sich gereckt und gestreckt. Ausgeatmet und wieder eingeatmet. Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Das Kind singt und hüpft. Immer wieder immer wieder immer wieder.
Ein Ablaufschema.
Ein Ablaufschema. Für die Quälung. Gibt es das Wort? Ihr Großvater hat es Quälung genannt. Auch ihr gegenüber. Er hatte nichts zu verbergen.
Ein Ablaufschema. Eine Reihenfolge. Und zwischen welchen Schmerzen welche Worte gesprochen werden müssen. Sätze. Worte.
Ein Schema. Ganz einfach. Das musste nicht immer Großvater machen. Er mochte sich nicht ständig die Hände schmutzig machen. Das konnte jeder.
Ganz einfach. Wirklich. Das konnte jedes Kind. Manchmal mussten sie sich gegenseitig durch die Quälung jagen. Die Worte in Kinderstimme.
Sie reagiert auf die Worte. Heute noch. Wie immer sie ihr präsentiert werden. Auch wenn Großvater längst tot ist.
Gibt es Hoffnung? Nicht viele glauben daran. Aber einige doch.
Er faltet Socken.
Er faltet Socken, steckt die winzigen Paare ineinander. Ärgert sich, wieviele kleine Hosen es schon wieder sind, wieviele kleine Unterhosen. Wenn der Kleine endlich richtig trocken werden würde, das wäre wenigstens etwas. Die Pullis gehen leicht. Die Unterhosen faltet er nicht, die wirft er auf einen Haufen in die Schublade im Kinderzimmer. Nicole hätte sie gefaltet. Immer beim Wäschefalten vermisst er Nicole. Und schämt sich dann, dass er sie nur für die Wäsche vermisst. Was vermutlich nicht stimmt. Wenn er darüber nachdenkt, und meistens will er nicht darüber nachdenken, dann vermisst er sie ständig, eigentlich immer. Aber das Vermissen im Alltag ist bereits so normal, der Schmerz so unerträglich, dass sein Bewusstsein ihm kaum noch was nach oben nach innen nach wahrnehmbar meldet. Während diese kleine blöde Situation am Wäscheständer, wenn er all diese Kleinkindwäsche faltet, die früher immer Nicole gefaltet hat – meistens lässt er den Ständer wochenlang stehen und zieht jeden Tag die Kleider direkt von den Drähten. Aber heute kommt seine Schwester zu Besuch. Und er möchte gerne so tun, als würde es ihm den Umständen entsprechend so halbwegs gut gehen, als wäre schon alles in Ordnung, als wäre das zu stemmen, für ihn, plötzlich allein zu sein mit dem Kleinen, und allein mit diesem Wehtun im Körper, jeden Tag, jede Nacht, seit Nicole gestürzt ist. Umgefallen. Und nie mehr aufgestanden. Er hätte es sich anders gewünscht. Mit neunzig noch gemeinsam unter dem Apfelbaum zu sitzen. Händchen halten. Sich mit warmen liebevollen Augen ansehen. Kurz hintereinander weg und friedlich und im Einklang mit Kind und Kindeskindern irgendwann einschlafen. Wie man so schön sagt. Friedlich eingeschlafen. So hätte er sich das vorgestellt, wenn er damals schon an den Tod gedacht hätte. Hat er aber nicht. Nicole ist ihm zuvorgekommen. Hinterhersterben darf er nicht, es gibt ja den Kleinen. Also faltet er Wäsche, drückt den Schmerz weg, beginnt zu putzen, das Geschirr wegzuräumen, den Küchentisch zu säubern. Wie festgewachsen manche Dreckstellen schon sind. Wieder schämt er sich. Scham und Schmerz sind eine schlechte Kombination. Sie wird es ihm ansehen, seine Schwester, sie kennt ihn gut. Seit sie ihre Mutter begraben haben, Kinder noch, der Vater schon weg, seit diesem Tag hatten sie jedes Gefühl geteilt, jede Stimmung, jede noch so kleine Veränderung. Ihre Gesichter waren füreinander lesbar gewesen, als hätten sie ineinander hineinschlüpfen können. Seine Schwester lebt im Ausland, daher ist sie nicht schon längst bei ihm gewesen, es ist keine einfache Zeit zum Reisen. Aber heute wird sie kommen. Und sie wird ihm ins Gesicht sehen und alles wissen. Den Wäscheständer packt er trotzdem noch weg.
Filmnacht.
Manchmal lohnt es sich, fremde Schicksale an mich ranzulassen. Zu weinen, Angst zu haben, allein zu sein. Mit andern.
In den Schuhen der andern.
In den Körpern der andern.
Bis meins keine Rolle mehr spielt.
Ich werde wieder schreiben müssen.
Ich werde wieder schreiben müssen. Ich werde auch über die jüdische Vergangenheit schreiben müssen. Über die Teile, die abgespalten sind.
Ich werde wieder schreiben müssen. Dürfen. Weil es nicht anders geht. Nicht mehr.
Ich werde wieder schreiben müssen. Nicht mehr jeden Tag. Aber oft.
Ich werde.
Es springt mich nicht mehr an.
Vor fast einem Jahr, am 30. April 2020, habe ich mit einer ersten Runde Kurztexte begonnen. Corona-Blog, habe ich das genannt. Weil mir die Kraft für die langen Texte gefehlt hat, neben Kindern zuhause, Spielplätze geschlossen, Kontaktverbot. Das war im ersten Lockdown, als alle noch dachten, das wird alles nicht so lange dauern. Auch ich dachte, kurz mal ein wenig überbrücken mit Kurztexten, Blog, ein Versuch. Über den Sommer habe ich an ‚adoptiert‘ gearbeitet, am dritten Teil, das war gut. Seither krebse ich wieder mit selten gewordenen Kurztexten im Blog mal seitwärts mal rückwärts. Vor einem Jahr dachte ich noch, über Corona werde ich nicht schreiben, das will ich nicht, eben darüber genau nicht. Und nun – nun bin auch ich bei den Corona-Texten angekommen. Immer mehr Texte handeln von den Maßnahmen. Ich fühle mich unfrei. Und etwas, das ich an der Schriftstellerei immer genossen habe, war mein Gefühl von Freiheit, von fast totaler Freiheit. Auch jetzt könnte ich mich hinsetzen, öfter als ich es tue, und über komplett jedes erdenkliche Thema schreiben, das mich gerade anspringt, lockt, in die Tiefe oder Höhe zieht. Nur springt mich kaum noch ein Thema an, so abgesättigt bin ich mit Corona. Und statt nett zu sein mit mir, hacke ich noch auf meinem eigenen Kopf herum – weil mich das ärgert, dass ich keine Wege mehr finde, ringsum, mitten durch, wie auch immer, aber weiterhin mein Ding zu machen. Ich mache es nicht mehr, „mein Ding“. Es springt mich nicht einmal mehr an.
Jetzt reicht’s.
Jetzt reicht’s. Aber was genau eigentlich. Keiner kann definieren, was genau bei ihm oder ihr das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wie man so schön sagt. Aber dass es so ist, dass es jetzt reicht, dass dieses ewige Hin und Her und dann doch wieder verschärfen und auf Kosten der Einzelnen und der Eltern und Kinder und überhaupt. Nein, was genau, ich weiß es auch nicht, er auch nicht, du auch nicht. Nur DASS es reicht. Und zwar gründlich. Und DASS es furchtbar ist, auch das wissen alle. Keiner kann mehr, keiner mag mehr. Vielleicht mag es immer noch richtig sein. Oder auch nicht. Aber auch das mag kaum einer mehr diskutieren. Sogar dort, wo die Meinungen auseinander gehen, haben sich die Diskussionen abgewetzt. Die Leute stehen wieder zusammen, die vorher auf Extrempositionen gegeneinander waren. Keiner weiß mehr so recht, was eigentlich gerade seine Position ist, wohinter er, sie, ich, du, ganz persönlich, überhaupt noch stehen können, stehen wollen. Die Extremsten in allen Richtungen beginnen, sich wieder zusammenzufinden. Über diesem einen kleinen Satz, der in sich auch keine geringste Änderung oder Lösung enthält. Aber aus tiefster Seele kommt. Jetzt reicht’s.
So langsam geht es ihm an die Nieren.
Masken. Testzwang. Eingeschlossensein. So langsam geht es ihm an die Nieren. Die Impfung bringt keinerlei Erleichterungen. Er dachte, nun endlich dürfte er sich wieder frei bewegen. Fehlanzeige. Selber entscheiden, welchem Risiko er sich aussetzen will? Fehlanzeige. Die dicke Maske muss sein, obwohl er andere auch durch die OP-Maske ausreichend schützt – und sich selber, sich selber schützt er mit dem dicken Stoff überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn er nicht mehr atmen kann, nicht mehr so richtig, dann wird es schnell eng in ihm. Das können viele gar nicht so richtig nachvollziehen. Manche tragen klaglos ganze Tage die FFP2-Masken und haben nicht das Gefühl, darunter zu leiden. Während er mit Panik kämpft, wenn er nur einmal schnell durch den Laden zum Milchregal rennt und zur Kasse und wieder raus. Wenn die Schlange im Kassenbereich zu lang ist, stellt er seine Milch ins Schnapsregal oder zu den Süßigkeiten und rennt auf die Straße. Für ihn ist die Maske keinesfalls eine kleine Misslichkeit, die es in Kauf zu nehmen gilt für das große Ganze. Für ihn ist das lebensbedrohlich. Er hat mit einem richtigen Panikanfall auch schon mal aufgehört zu atmen, er möchte eine solche Kante nicht nochmals erleben. Oder nicht so schnell jedenfalls. Seither ist Atemnot wahrscheinlich noch ein wenig bedrohlicher geworden, für sein inneres Alarmsystem. Da kann er nichts dafür. Mit der Maskenbefreiung kommt er auch nicht mehr durch. Drei Security-Leute sind ihm kürzlich im Drogeriemarkt hinterhergerannt, haben ihn lautstark beschimpft und handgreiflich auf die Straße gestellt. Ärztliches Attest hin oder her. Seither rennt er mit Maske durch die Läden, falls seine online-Bestellung Fehlartikel enthielt – oder die nächste Lieferung noch zu weit weg. Kurzfristig kann man sich ja schon lange nichts mehr liefern lassen. Für wen dokumentiert er das alles eigentlich? Für die Menschen, die nach Corona kommen? Die sich nicht mehr werden vorstellen können, dass man mal mit dicker Haut vor dem Mund rumgelaufen ist, kaum atmen konnte und sich jeden zweiten Tag Stäbchen bis zu zwei Zentimeter weit in die Nase hochgeschoben hat und mindestens zehnmal ringsum gedreht über mindestens fünfzehn Sekunden pro Nasenloch. Undsoweiter. Manchmal möchte er Mäuschen spielen und als Archäologe auf all die Schichten nie verrotteter Masken und Stäbchen stoßen. Allüberall. Und sich eine Geschichte ausdenken, was damals wohl gewesen sein mag, was für eine Mode, oder Kultur, oder Religion.
Gut, dass du gekommen bist.
Gut, dass du gekommen bist. Ich helfe dir. Lass uns anfangen.
Seine alte Mutter.
Seine alte Mutter. Sie ist gar nicht sehr alt, aber sie fühlt sich alt, oder durch ihr Alter gefährdet. Euch Jungen wird es ja nichts ausmachen, aber wir Alten, wir nippeln dann ab oder was. Nein nein, das will sie um keinen Preis. Sie hat sich früh verrenten lassen, ist mit ihren 63 Jahren glücklich im Ruhestand, und den will sie sich jetzt nicht gefährden lassen. Durch nichts und niemanden. Nicht mal seine Neffen und Nichten will sie sehen, ihre Enkelkinder. Das kann er nun ja gar nicht mehr verstehen. Die Familie seines Bruders hat sie ein paar Monate lang noch immer mal unten auf der Wiese vor dem Haus besucht, mit Masken und Abstand und draußen, kein Kuscheln für die Kinder, Fußballspielen und Frisbee, aber immerhin die Oma sehen, ihr Lachen hören. Aber seit Juli bereits weigert sie sich, noch auf die Wiese vor das Haus zu kommen. Sie hat die Einschulung ihres ältesten Enkels verpasst, obwohl die draußen stattfand, mit viel Abstand zwischen den einzelnen Familien und Maskenpflicht für die Erwachsenen, mitten im Sommer. Nein, zur Einschulung kann ich leider nicht kommen, wo denkt ihr hin, ihr wollt mich wohl noch ins Grab bringen. Er konnte das schon lange nicht mehr hören. Einkaufen ging sie ja auch, mit Maske. Wieso sollte sie ihre Familie nicht mehr treffen, mit Maske. Er wollte sie nicht mehr verstehen, er gab sich nicht mal mehr Mühe. Sollte sie sich einigeln. Er hatte sie jetzt auch bereits seit acht Monaten nicht mehr gesehen, obwohl er um die Ecke wohnte. Und wenn sie jetzt sterben sollte, an was ganz gewöhnlichem oder trotz aller Vorsicht an Corona, und sie hatte seit Monaten keinen von der Familie mehr gesehen. Für wen, bitte schön, sollte das denn gut sein. Nein. Er wollte sie nicht verstehen. Er weigerte sich, noch mit ihr zu telefonieren. Wenn er nicht auf den allerersten Impfzug aufsprang, oder sich doch mal mit einem Freund im Park zum Bier traf, war er ja schon Corona-Leugner und schuld an der ganzen Misere, wegen solchen wie ihm war der ganze Spuk nicht schon lange vorbei. Das gab er sich nicht mehr. Nein danke. Aber ja, das hätte er trotz allem nicht gedacht, dass es nach fast vierzig Jahren Mutter-Sohn in leidlich gutem Verhältnis noch zu solch einem Zerwürfnis, einem regelrechten Bruch kommen konnte. Er war sich nicht sicher, wenn diese ganze Sache irgendwann vielleicht dann doch ausgestanden sein sollte, ob diese Kluft zwischen ihnen sich je wieder würde schließen lassen. Im Moment hätte er nicht mal mehr sagen können, ob er es überhaupt noch wollte.
Party.
Party. Ist das real? Sie lehnt sich zurück, allein im Dachgeschoss der Nachbarn, ein kleines Büro mit Sternenblick. So richtig abtanzen, das wird sie sich nicht trauen, das weiß sie jetzt schon. Wegen der Leute unter ihr, auch wenn sie ihr versichert haben, dass es sie nicht stören würde. Sie weiß trotzdem, dass sie jeden Sprung und jedes Aufstampfen hören werden. Aber wenigstens sich ein wenig wiegen, im Takt der Musik. Ein Glas Wein in der Hand. Sich Wiegen im Takt von zweihundert sich wiegenden Menschen. Mit Gläsern in der Hand, oder ohne. Sanft tanzend, oder wild. Zweihundert! Online! Sie ist sich sehr bewusst, dass es ihr nie das richtige Tanzen ersetzen wird. Niemals! Tanzen gehen, der Geruch schon nur, Aufregung, Schweiß, Holzboden, Menschen, Getränke, die Lautstärke, der Sauerstoffmangel, Knabbereien am Rand. Die Oliven, der Fetakäse. Solche Dinge hat sie sich auch gerichtet, heute. Der Geruch stimmt trotzdem nicht. Es riecht nach muffigem Dachkammerbüroraum. Aber besser als unten mit den Kindern ist es allemal. Sie ist aufgeregt wie vor einer richtigen Party. Oder mehr noch. Soll sie das Video anmachen oder schwarze Fläche bleiben, sie weiß es noch nicht. Aber dabei sein, das will sie jetzt. Das hat sie sich versprochen. Und ihrer Freundin, die ihr gut zugeredet hat, seit Wochen schon, dass sie dringend etwas für sich selber tun müsse. Die ihre Ausreden nicht mehr hatte gelten lassen, dass das zurzeit ja alles gar nicht möglich sei. So hatte sie den Link aufgerufen, sich im Vorfeld registriert, einen zoom-Link erhalten, wie das heute alles so ist. Und gleich wird sie tanzen, mit zweihundert anderen.
Tumor.
Er weiß nicht, ob sich die Anstrengung lohnen wird. Er geht weiter mit dem Hund. Er geht weiter zur Bestrahlung. Er lässt seine Haare ausgehen und wieder wachsen. Er geht mit dem Hund. Er grüßt die Nachbarn. Manchmal spricht er mit jemandem. Die Sonne scheint, die Blumen blühen. Krokusse, Osterglocken. Bald ist Ostern. Was verspricht das Osterfest? Manchmal weiß er die einfachsten Dinge nicht mehr. Die er in der Sonntagsschule gelernt hat, als Kind schon. Manchmal vergisst er, aufzustehen. Zum Glück hat er den Hund. Und den Wecker am Handy. Der ihn losschickt, zur Bestrahlung, zur Chemo, zum Arzt, zur Apotheke. So viele Termine, seit er in Rente ist. Das hat er sich anders vorgestellt. Und doch geht er weiter mit dem Hund. Morgens und mittags und abends. Grüßt die Nachbarn. Manchmal wechselt er ein paar Worte. Er kann noch lächeln. Die Menschen mögen ihn. Kaum einer weiß, wie es ihm geht. Man sieht es ihm nicht direkt an. Dass er ein wenig dünner geworden ist, vielleicht, aber das steht ihm eher gut. Wie er sich fühlt, innen, das will er eigentlich keinem zeigen. Er ist müde. Er mag nicht mehr essen. Aber er geht mit dem Hund. Und sieht die Blumen. Frühling. Die Sonnenstrahlen. Die Wärme. Manchmal kann er genießen. Kleine Momente lang.
Die Sicht verschwimmt.
Die Sicht verschwimmt. Das ist immer das erste Anzeichen. Danach erkennt er die Menschen nicht mehr, erinnert sich nicht mehr an ihre Namen, kann keine geraden Sätze mehr bilden. Am besten verschwindet er dann ins Bett, unter die Decke, dort fragt ihn auch keiner mehr nach einem Wort, das er nicht mehr finden kann, in seinem seltsamen Kopf. Als Kind hatte er sich das als seltsames Gewächs im Gehirn vorgestellt, das größer und größer wird, an manchen Tagen auf die Augen drückt, an andern auf die Wörter, oft auf alles gleichzeitig. Und das ihm einredet, nichts wert zu sein und sich umzubringen am besten. Theorien, wer ihm nächtlich das Gewächs ins Gehirn gepflanzt hatte, waren damals viele in seinem Kopf unterwegs, wilde Geschichten, an die er sich heute nicht mehr erinnern kann. Es waren meistens Ärzte, das wusste er noch, Ärzte aus der Nachbarschaft, da gab es so einige. Wie und wo und wann genau sie das aber gemacht hatten, dieses Gewächs in seinen Kopf zu pflanzen, das wusste er nicht mehr. Auch an die Namen der verschiedenen Ärzte konnte er sich nicht mehr erinnern. Sein Großvater war auch so einer. Dessen Namen kannte er noch. Aber die waren so oder so alle schon tot, die konnte er nicht mehr fragen. Und heute glaubte er auch nicht mehr so recht an die Geschichte mit dem Gewächs im Gehirn, an die Geschichte mit seinem seltsamen Kopf. Irgendwie hatte er diese Geschichte immer gemocht, sie hatte ihn auch ein wenig zu etwas Speziellem gemacht, nicht nur seltsam, sondern auch speziell. In gewisser Weise ein Wunder für die Wunderkammer. In Formalin einlegen und in Glas einschließen. Das wäre auch eine Variante gewesen. Stattdessen hatte er sich entschieden, weiter zu leben, der Stimme zum Trotz. So lebt er heute noch. Heute sprechen die Leute eher von Dissoziation und traumabasierter Amnesie. Viel logischer und schlüssiger als seine damaligen Kindergeschichten ist das alles für ihn keinesfalls. Nur weniger abenteuerlich, weniger wild. Eigentlich schade.
eine Blase um mich
Er hat eine kleine Blase um sich. Viel Platz bleibt ihm nicht mehr. Aber immerhin. Er hat keine Lust, sich noch weiter die Nachrichten anzuhören. Er wird auch nicht beginnen, sich vor jedem Treffen mit Freunden zu testen. Oder einen Impfnachweis mit sich rumzutragen. Oh nein. Er bleibt schön mal zuhause in seiner Blase. Home office, Essenslieferungen, den ein oder andern Videochat mit einem Kollegen, abends ein Bier auf dem Sofa, Netflix, so lässt sich leben. Oder überleben. Auf alles andere hat er keine Lust mehr. Manchmal fürchtet er, dass es nie ein Ende nimmt, oder dass er nicht mehr rauskommen wird aus seiner Blase, wenn es endlich vorbei sein wird. Aber dann schaut er sich noch einen weiteren Film an, trinkt noch ein weiteres Bier. Ein paar Chips, ein wenig Schokolade. Er ist sicher nicht der einzige, der zurzeit so lebt. Zum Glück hat er keine Kinder, muss keine Entscheidungen treffen, täglich, wen sie sehen dürfen und wen nicht, oder trösten, wenn einer nicht zum Kindergeburtstag kommt. So allein kann er ruhig noch ein wenig länger allein sein, sich einsperren in seiner Blase, sich schützen vor den Forderungen der Verantwortungsvollen. Er wird sich nicht testen lassen. Auch wenn er dann nicht zurück an den Arbeitsplatz darf. Hier zuhause ist doch alles in Ordnung. Lasst ihn doch einfach alle in Ruhe. Danke.
freundliche Geschichten
Wie war das schon nur, mit den freundlichen Geschichten? Bachmann, Malina. Ein schönes Buch für Milan. Anna erinnert sich nicht genau. Aber so ähnlich, oder? Auch die Bachmann hätte gerne einmal (einmal!) ein schönes Buch geschrieben. Da Anna so lange nicht mehr geschrieben hat, wühlt sie wieder im Dreck. Das ist immer so, wenn sie wieder zu schreiben beginnt. Als wäre sie zwanzig und würde zum ersten Mal die Wut der späten Pubertät zu Papier bringen. Wann immer sie lange Pausen hat, im Schreiben, entsteht wieder lauter Dreck. Oder was mutter „Dreck“ nennen würde. Und es auch immer noch tut, jeden Tag, innen, in ihr. Anna weiß viel zu oft nicht, was sie selber eklig findet und was wieder die Stimme von mutter ist. Sie wird mutter immer hören, da gibt sie sich keinen Illusionen hin. Sie war nun mal ein schlimmes Kind gewesen, direkt von Anfang an, von der ersten Nacht an quasi, weil sie nicht durchgeschlafen hat, als Neugeborenes, und auch keine vier Stunden durchgehalten hat. Und geschrieen. Geschrieen geschrieen geschrieen. So ein Kind kann man ja nicht lieb haben. Geschweige denn aushalten. Noch heute wird Anna wütend, wenn sie ältere Leute sagen hört, oh, ist das ein braves Baby. Brav!, als könnten Babys brav sein – oder nicht brav. Sie jedenfalls, geborene Anna Gehrens, Gehrens wie ihr Vater, Anna wie ihre Urgroßmutter, sie jedenfalls war von Anfang an schlimm gewesen. Mit gaaanz viel Dreck. Auch das von Anfang an. Kein einziges Sonntagskleid, das auch nur einen halben Tag lang sauber geblieben wäre. Manchmal nicht mal heile. Sonntagskleidchen. Sonntagsmanieren. Anna Gehrens könnte spucken. Wie so oft fragt sie sich wieder, ob ihr Buch je ein Buch werden wird. Mit so viel Dreck und Spucke. Anna hat das alte Manuskript hervorgeholt, die Zeilen von vor fünfzehn Jahren. Weil sie gerade so viel Zeit hat. Mit dem Cello ist nichts mehr los, keiner bucht sie, sie hat längst Grundsicherung beantragt. Wie damals. Und das ist doch alles lange her. Doch nun hat sie wieder Zeit. Sie blättert durch die Seiten, vierhundert Druckseiten Rohtext, und beginnt zu streichen, zu ergänzen, neu zu formulieren. Vielleicht hat Grundsicherung auch etwas Gutes. Sie muss sich um nichts mehr kümmern, nicht mal mehr ums Essen, das holt sie bei den Engeln, alles andere kann sie sich nicht mehr leisten. So hat sie Zeit, die Anna Gehrens, seit langem zum ersten Mal. Das Cello schweigt. Und Anna schreibt, schreibt um, zweifelt, schreibt neu, streicht, zweifelt, schreibt weiter.
Ein letzter Fick für heute (Triggerwarnung)
Die Kinder in der Badewanne. Sie ist froh, die Stimmen zu hören, auch wenn sie mal wieder streiten. Solange sie streiten, sind sie nicht ertrunken. Sie wird den Teufel tun und gucken gehen. Sollen sie streiten. Sie will ihre Ruhe haben und nochmals einen Fick anschauen. Einen noch. Einen letzten für heute, versprochen. Sie würde sich abends mit den Kindern ins Bett legen, das mochten die beiden, und wenn sie hoffentlich gleich mit einschliefe, dann wäre sie nicht mehr gefährdet, doch wieder online zu gehen, obwohl sie es sich so sehr vorgenommen hatte. Nur noch einen, für heute. Obwohl ihr Schambereich schon wund war. Sie konnte es nicht lassen, ihre Finger hineinzustecken, so tief wie möglich, trotz der frisch gemachten Nägel. Das war keine gute Idee gewesen, sich die Nägel machen zu lassen, weil man endlich wieder Nägel machen lassen konnte, für kurze Zeit vielleicht nur, mit Termin. Seit dem Lockdown war sie immer weiter abgedriftet. Sie hatte nicht mal überlegt, dass das mit den Nägeln ein Problem werden könnte. Sie hatte sich nach zwei Tagen mit den neuen Nägeln den alten Gürtel von Opa rausgesucht und hinter dem Rücken mit viel Mühe geschlossen, damit sie heute vielleicht nicht mehr hineinfahren würde in ihr Innerstes, mit den Bildern, den Filmen, diesen schamlos verworfenen Nutten. Frauen sah sie sich an, sie wusste auch nicht, wieso. Das andere war ihr zu hart. Oder zu obszön. Oder zu grob, zu brutal, vielleicht auch das. Obwohl sie von Tag zu Tag brutalere Bilder suchte, auch unter den Frauen. Auch da wusste sie nicht, wieso. Aber wieso sind die Kinder so still, die sind doch sonst nie still. Sie dreht sich um, in Richtung Badezimmer, um zu horchen. Sie dreht sich um, die Hand tief im Schoß, hinter sich den Bildschirm mit den Bildern. Vor ihr, im Türrahmen, zwei mucksmäuschenstille Kinder mit großen Augen und blassen Gesichtern und Angst unter der Haut. Sie wird sie nicht verprügeln, die beiden können ja nichts dafür. Langsam zieht sie ihre Hand heraus und wischt sie ab. Schließt alle Fenster am Bildschirm, löscht den Verlauf, wie immer. Versteckt den besonderen Browser, loggt sich aus und fährt den Computer runter. Ganz in Ruhe, als hätte sie bis eben gearbeitet, drückt sie den Laptopdeckel zu und dreht sich wieder zu den Kindern um. Habt ihr Hunger?
Es schneit.
Es schneit, draußen, vor dem Fenster. Ich habe meinen Blick vom Bildschirm gelöst und merke, wiesehr ich gleich aufatme. Rausschauen. Schneegestöber. Bewegung im Körper.
–
Er ist aufgewacht in diesem Krankenhausbett. Er sieht und hört. Aber er kann nicht mal die Augen bewegen, geschweige denn den Kopf. Wenn die Schwester aus seinem Blickfeld verschwindet, kann er ihr nicht folgen, mit den Augen, wiesehr auch ihr Lächeln ihn beruhigt hat. Für Sekunden. Bevor die Panik sich wieder ausbreitet. Dieses Kribbeln im Körper. Überall. Wird er je wieder sich bewegen können?
Sie hat ihm erklärt, was er vom Arzt nicht verstanden hatte. Der Arzt war nicht mal in sein Blickfeld geraten. Der hatte sich nicht mal vorstellen können, dass das für ihn einen Unterschied hätte bedeuten können. Der Arzt redete und redete – und er konnte ihn nicht verstehen. Die Schwester heute hat sich über ihn gebeugt. Seinen Blick gesucht. Ihn angelächelt. Wie gern hätte er zurückgelächelt!! Aber irgendwie schien sie zu spüren, auch ohne Lächeln, dass er Kontakt aufgenommen hatte, dass er „da“ war, in seinem Körper. Hinter der Unbeweglichkeit. Und dann blieb sie da oben, direkt über seinen Augen, mit ihrem freundlichen Lächeln. Wendete den Blick immer mal wieder ab, ließ ihm Pausen, sah ihn wieder an. Und blieb, mit diesem Lächeln. Und dann sprach sie wenige Sätze. Auch diese mit Pausen. Dass er einen Krankenhausvirus erwischt hatte. Dass er sich wieder vollständig würde bewegen können. Dass es viel Zeit benötigen wird.
Er sackte in sich zusammen, ohne eine einzige Bewegung. Erleichterung. Und kaum war das Gesicht weg, das Lächeln, die Stimme – kam die Panik zurück. Stimmte das? Konnte das stimmen? Wird er sich je wieder bewegen können?
–
Jetzt scheint die Sonne, draußen, vor dem Fenster. Es tut gut, aus dem Fenster zu schauen. Diese katatonen Zustände beschäftigen mich. Und es sind nicht meine. Ich kann meine Augen hinausbewegen, zu den Wolken, der Sonne, den blauen Himmelsflecken. Aprilwetter, mitten im März. In Berlin ist immer noch Winter, hat mir mein Mann erklärt. Mein Körper sehnt sich nach Sonne und Wärme. Nach Frühling.
Ich werde versuchen, wieder regelmäßiger zu schreiben. Lange hatte ich gedacht, dass es mir nicht fehlen würde. Aber es fehlt mir. Es tut mir nicht gut, nicht mehr zu schreiben. Es ist, als würde ein Teil von mir erstarren, kataton, bis sich kaum noch etwas rührt. Und das beeinflusst mein ganzes Leben. Ich übertreibe nicht.
Bitte erinnert mich, wenn ich es wieder vergesse. Dass ich das brauche, dieses Schreiben.
kataton.
Sie kann nicht mehr. Sie kann mal wieder nicht mehr. Die Welt verschwimmt. Die Sicht wird pixelig, krümelig, an den Rändern ausgefranst. Radfahren kann sie noch. Eigentlich dürfte sie nicht mehr radfahren, in diesem Zustand. Den Frauen in der Beratung empfiehlt sie immer, noch eine Runde zu gehen, das Rad zu schieben, bitte nicht zu fahren! Und sie selber? Heute ist sie aus der Beratungsstelle raus wie eine ihrer Klientinnen. Schräg auf die Straße, Vorsichtsmaßnahmen außer acht lassend, nichts mehr sehend, keine Tränen, nur zusammengebissene Zähne und keine Ahnung mehr von gar nichts. Woher warum woher jetzt warum jetzt was war es gewesen war eine dabei gewesen die sie hätte kennen müssen von damals eine von ihnen oder warum woher – sie wusste es nicht.
Sie fuhr nicht mehr, sie schob nicht, sie stand. Oben auf der Brücke, mit keuchendem pfeifendem Atem, die Allergie, aber nicht nur. Die Gleise unten hinter Schleier, der Fernsehturm wie im Nebel, Sonnenschein der wehtat im Gehirn, Gummi in den Beinen zugleich steif wie Brett wie Holz wie Stock wie Baum. Sie hätte sich nicht vom Fleck rühren können. Woher es kam hätte sie immer noch nicht sagen können. Jetzt fragte sie es sich auch nicht mehr. Der Vorteil an den katatonen Zuständen war, dass sie nicht mehr denken konnte, nicht mehr fühlen musste, nichts mehr sah, nicht mehr wirklich. Es war nicht alles ok, das nicht, aber es war auch nicht schlimm. Es war eher wie gar nichts. Auch nicht Tod, das war nochmal anders. Sie hatten sie zwar wieder geholt, aber Sterben, das war irgendwie schön gewesen. Kataton dagegen, das war gar nicht. Sie konnte sich sehen und doch nicht sehen. Es war ihr egal und doch nicht egal. Sie wusste nichts, weder von jetzt noch von vorher.
Wie aus weiter Ferne ahnte sie, dass jetzt kein Bekannter kommen durfte, keiner sie ansprechen, weil dann gleich wieder der ganze Aufzug begann, mit Krankenwagen und Polizei und Psychiatrie. Bitte nein. Kein Bekannter, nicht jetzt. Ansonsten war der Platz gut gewählt. Oben auf der Brücke standen oft Menschen, sahen in die Ferne, standen dort lange, manche telefonierten, manche sahen einfach über die Gleise, zählten S-Bahnen, Regionalbahnen, Fernzüge, machten gar nichts. Sie konnte lange dort stehen, solange sie nicht in die Nacht hinein stand. Aber manchmal ließ es schnell wieder nach. Nur Geduld. Und stehen bleiben. Sich nicht rühren – haha – der Humor kam wieder, sie konnte sich ja nicht rühren, das war es ja. Aber ja, ganz still stehen, keine Panik im Innen, ruhig bleiben, ruhig werden, was immer da gewesen war, so ruhig werden wie irgend möglich, bis irgendwann die Muskeln wieder locker ließen, die Nerven, was immer da festhalten mochte. Sie würde dann eine Weile schieben müssen, das wusste sie schon. Aber danach wäre alles wieder gut.
schlaflos.
Sein Kind hat ihn geweckt. Statt sich wieder hinzulegen, hat er seinen Rechner aufgeklappt. Am Küchentisch. Der Küchentisch ist der einzige Ort ohne Kinderkram. Und nachts ist die einzige Zeit, in der er arbeiten kann. In Ruhe. Abends fällt er meist mit dem Kind ins Bett. Erschöpft. Nicht mal mehr müde. Viel mehr als müde. Und nachts, wenn er geweckt wird, kann er dann nicht mehr einschlafen, neben dem wieder schlafenden Kind, wälzt sich lange, denkt an todo-Listen, an Arbeit, an Geld, an Verzweiflung. Steht irgendwann doch auf. So hat er sich langsam angewöhnt, einfach immer direkt aufzustehen, wenn er das erste Mal aus dem Schlaf gerissen wird. Manchmal ist das um Mitternacht, manchmal erst morgens um drei. Aber ein paar Stunden Ruhe bleiben ihm dann immer noch, bis der Kleine wieder da steht. Und Hunger hat. Tagsüber geht dann gar nichts. Den Mittagschlaf macht er leider meistens auch mit. Weil der Kleine sich nicht hinlegen will ohne ihn. Und er zu erschöpft ist, um nicht einzuschlafen, wenn er sich mitten am Tag mit hinlegt. Und wenn er es mal schafft, wach zu bleiben, räumt er Kleider weg oder startet eine Waschmaschine oder räumt den Geschirrspüler aus und gleich wieder ein, weil so vieles sich schon wieder neben der Spüle stapelt. Den Tisch wischt er meist erst nachts, bevor er den Rechner aufklappt. Neben eingetrockneten Töpfen auf dem Herd und saurer Milch in den Abendfläschchen, die seit drei Tagen stehen geblieben sind, er hat einfach ein paar mehr bestellt, die großen Versandhändler mag er zwar nicht unterstützen, aber im Moment verzichtet er auf Ethik, alles was ins Haus kommt, ohne dass er den Kleinen in Winterklamotten stecken und zum Rausgehen zwingen muss, undsoweiter. Eigentlich will er über all das nicht mehr reden. Es ist wie es ist, er kann es ja doch nicht ändern. Alleinerziehender Vater zu sein war schon immer nicht lustig. Im Gegensatz zu den alleinerziehenden Müttern hatte er zwar immerhin noch Wertschätzung, Respekt, manchmal Bewunderung oder pures unverhohlenes Mitleid. Aber jetzt sieht ihn kaum noch einer. Er ist der einzige auf seiner Arbeitsstelle, der so gut wie gar nichts mehr geregelt kriegt. Keiner will mehr ein Projekt mit ihm zusammen machen. Er war der erste, der auf Kurzarbeit musste. Ein Gesetz gegen Diskriminierung von Vätern im Beruf, das gibt es nicht. Er hätte sich auch nie im Leben dafür stark gemacht. Wäre er jetzt nicht selber betroffen. Vielleicht hilft es, wenn Menschen wie er sich jetzt zu wehren beginnen. Nachts, wenn er den Rechner hochfährt, arbeitet er nicht für seinen Chef. Nicht mehr. Der soll ruhig wissen, was neben der Dauerbetreuung eines Zweijährigen noch so alles möglich ist. Oder eben nicht. Nachts, da arbeitet er für die Väter. Und ein wenig auch für die Mütter. Auf dass sich etwas ändern möge. Auf dass sie wenigstens einen Sinn gehabt haben wird, diese seltsame schwierige Zeit. Er atmet einmal tief ein und aus, steht auf und stellt sich einen Moment zum Kind. Dieses kleine schlafende atmende Wesen, das er zurzeit manchmal nur noch nachts so richtig richtig lieben kann. Aber dann liebt er, immer wieder, jede Nacht.
Ich möchte, dass du weiterlebst!
Ich möchte, dass du weiterlebst!
Und ja, es ist eine scheisse schwere Zeit.
manchmal möchte ich großmutter fragen.
manchmal möchte ich großmutter fragen. warum sie meiner kleinen Schwester verboten hat, in den Keller zu gehen. und mir nicht.
manchmal möchte ich großmutter fragen. warum sie mich in den Keller geschickt hat. immer wieder. Wasser zu holen. oder Wein.
manchmal möchte ich großmutter fragen. warum meine kleine Schwester mehr wert war als ich.
manchmal möchte ich großmutter fragen. warum. wenn sie doch wusste.
ich werde sie nicht fragen. großmutter ist lange schon tot.
Ich stütze mich.
Sie sagt es vor sich hin. Immer wieder. Ich stütze mich ich stütze mich ich stütze mich. Sie weiß nicht, wie das geht. Aber der Mann, der ihnen hilft, der Mann vom großen Schiff, der hat ihr das gezeigt. Die Hände hinten unten an den Rücken legen, angewinkelte Ellenbogen, die Handflächen an den Nieren. Sie weiß nicht genau, wo die Nieren sind. Aber der Mann hat gesagt, das hilft. Wenn es wieder ganz schlimm sei, wenn sie wieder von Bord springen wolle, dann solle sie beim nächsten Mal ihre Hände nehmen, sie in den Rücken legen und sich selber stützen. Sie weiß nicht, ob es funktioniert. Aber irgendwie, irgendwie scheint es zu helfen. Sie fühlt sich nicht mehr ganz so allein. Obwohl sie noch genau so allein ist. Sie ist jetzt zwölf, sie ist jetzt erwachsen. Sie ist über Nacht erwachsen geworden. Ihre Eltern sind im Meer geblieben. Und die kleine Schwester. Und der winzige Bruder. Der wird als erster ertrunken sein. Der Kleine konnte ja noch nicht mal krabbeln, wie hätte er denn schwimmen sollen. Sie wusste ja selber kaum, wie sie an Bord gekommen war. Der eine junge Mann, der ihr was zu Essen gegeben hatte, in der Nacht, auf dem kleinen Boot, der hatte sie plötzlich um den Hals gepackt. Und sie angefleht, sich ruhig zu verhalten, nicht zu schreien, nicht um sich zu schlagen, still zu liegen. Wenn sie nicht seit Ewigkeiten schon unterwegs gewesen wäre und immer hätte still sein müssen, lautlos, bewegungslos, sie hätte es nicht gekonnt, in dem kalten dunklen Wasser. So schloss sie die Augen, konzentrierte sich auf ihren Atem, hielt ihn so klein und flach und lautlos wie möglich, zählte die Atemzüge, versetzte sich nach Hause, auf die Farm, in den Stall, zu den Tieren. Wie warm es dort war. Zwischen den Leibern. Wie laut sie atmeten, die Tiere. Und sich sachte hin und her wiegten. Bis kräftige Arme sie gepackt hatten. Und von dem Körper des jungen Mannes gerissen. Der unter ihr fast ertrunken wäre, der absackte wie ein Stein, den einer der Taucher einfing, an Bord hievte, übers Knie legte. Sie würde es schaffen, ihren Eltern zuliebe, die es nicht geschafft hatten. Ihrer Schwester, ihrem winzigen Bruder zuliebe. Sie wusste nicht, was auf sie zukommen würde. Aber sie wusste ganz genau, dass diese ihr liebsten Menschen um keinen Preis gewollt hätten, dass sie sich über Bord warf. Sie würde es aushalten müssen. Sie war dem freundlichen kleinen weißen Mann dankbar. Der jede Stunde einmal über ihr Deck lief, bei jedem kurz stehen blieb, zwei Worte oder drei Blicke wechselte. Und der ihr gezeigt hatte, wie sie sich selber stützen konnte. Wenn es wieder ganz schlimm wurde.
Musik
die Lippen verspannt, der Mund tut weh. die Klarinette seit Jahrzehnten nicht im Mund gehabt, in der Hand, zwischen den Lippen. auf dem Daumen, der sofort wehtut, wie früher, anders als früher, ähnlich wie damals, als wäre die Erinnerung im Daumen, und das blosse Auflegen des Instruments würde reichen, den Schmerz wieder hervorzurufen, noch bevor er die ersten Töne gespielt. und dann der Ton. auch in den Ohren tut es weh, nicht nur die Lippen die Wangen der Kiefer der Kopf. die Lippenspannung ist nicht mehr vorhanden. oder viel zu viel davon. kein Klang, kein Ton. keine Resonanz im Raum. ein Brett, ein Stück Holz, ein Stock. was soll er damit. was hat er sich vorgestellt. dass er einfach wieder würde anfangen können? und es gleich klingen und ihn glücklich machen würde? am liebsten hätte er getobt gestampft gewütet, ein kleines Kind. das Holz in die Ecke gepfeffert, die Mechanik verbogen, das Holz gesplittert, der Rumpf, der Körper, Klangkörper. und sein eigener Körper, der hart geworden war, in all den Jahren ohne Musik. er hatte die andern spielen lassen. war in die Konzerte gegangen. hatte sich eingelullt, dass das reichen würde. aber seit es keine Konzerte mehr gab, schien es nicht mehr zu gehen. sich einzulullen. er vermisste die Musik. und nicht aus dem Computer, youtube, facebook, nein. die echte Musik! und wenn er sie nirgends mehr haben konnte. dann musste er sie wohl oder übel selber machen. er hielt sich zurück, so gut es ging, warf sein geliebt-gehasst-geliebtes Instrument nicht in die Ecke. sondern befühlte es, mit jeder Faser seiner Fingerkuppen, mit den Lippen, mit der Zunge. bis er sich traute, nochmals anzusetzen. zu einem Ton. und ihn schwingen ließ. im leeren Zimmer.
Vor zwei Jahren.
Vor zwei Jahren ist sie gegangen. Hat mit ihrem Kuscheltier das Haus verlassen. Ist mit allen zur Tram gegangen. Wurde umarmt und bewinkt. Und das war’s dann. So schnell ist eine Schwester weg. So schnell ist eine Tochter weg. Wie seltsam das Leben ist. Sein kann. Und manche Kinder sind in Familien für nur ein Jahr. Um dann zurückzugehen. Oder weiter. In neue Familien. Oder alte. Vielleicht haben sie ein paar Dinge mitgenommen, innerlich. Vielleicht wichtige Dinge. Vielleicht überlebenswichtige.
Eingesperrt.
Der Radius wird auf 15 Kilometer beschränkt. Sie hätte nicht gedacht, dass das gleich zum Kotzen reicht. Und es hat. Sie hat sich über die Kloschüssel gebeugt und die Müslireste vom Frühstück ausgespuckt. Zusammen mit dem schwarzen Tee, der sie wachhalten sollte. Nach einer schlaflosen Nacht. Eine ziemlich schwärzliche Brühe. In der Nachbarwohnung tobt ein Kind. Heulen Schreien Kreischen gegen die Wände hauen. Immer wieder. Jeden Tag. Sie kann es nicht mehr hören. Sie möchte nicht das Kind sein, natürlich nicht. Auch nicht die Eltern, um keinen Preis. Und dennoch. Sie möchte gegen die Wände schlagen. Ein Ultimatum stellen. Nun darf sie nicht mal mehr zum See. Am See hat sie ihren Lieblingsplatz. Sie nimmt jeweils das Rad, fährt zwei Stunden über die Felder, setzt sich eine Weile ans Wasser bis ihr kalt wird, und fährt zwei Stunden zurück. Sie radelt schnell. Der See ist deutlich weiter weg als 15 Kilometer, auch vom Dorfrand aus gerechnet. Sie weiß nicht, wie sie das überleben soll. Eingeschlossen zu werden in einem kleinen Dorf, das sie sich nicht selber ausgesucht hat, in das sie gesetzt wurde für ihr Vikariat, bevor sie als Pfarrerin endlich wieder selber wählen kann, ein bisschen wenigstens, wo sie jetzt arbeiten möchte. Nun darf sie nicht mal mehr reinfahren, nach Berlin. Sie lebt im Hotspot, was kann sie denn dafür. Sie wurde als Kind eingesperrt, was kann sie denn dafür. Sie wird das nicht überleben, in diesem Dorf eingesperrt zu werden. In der Stadt kommt ja kein Ordnungsamt mehr hinterher, aber hier draußen, hier haben die Beamten Zeit. Ordnungsamt oder Polizei werden den See kontrollieren. Weil viele zum See fahren. Und der Spielplatz auf der andern Seeseite auch die Familien anzieht. Von allen Dörfern ringsum. Alle mehr als 15 Kilometer entfernt. Wie soll das nur werden. Wenn sie jetzt schon das Kotzen ankommt. Und die Regel gilt doch gerade erst.
Eine Geschichte.
Du möchtest eine Geschichte. Eine richtige Geschichte. Ich weiß. Am liebsten eine Kindergeschichte. Mit Anfang und Ende. Eine Geschichte, die traurig ist. Aber auch gut ausgeht. Mit der man einschlafen kann. Auch das.
Ich werde dir eine Geschichte schreiben. Irgendwann.
Deine Geschichte.
Fragmentiert.
Meine Geschichten haben kein Ende. Sie schweben. Sie haben oft auch keinen Anfang.
Fragmentiert. Zerrissen.
Irgendjemand wird es lesen wollen. Genau deswegen.
Ich blute Sperma aus.
Ich blute Sperma aus. Hinter dicken Theatervorhängen. Und es hat nichts obszönes. Das Blut tropft auf den Boden. Das Sperma düngt die Erde. Käfer Fliegen Würmer. Wurzeln. Keimlinge.
Ich blute Sperma aus. Die Dammwand gerissen. Keiner näht mich. Ich bleibe liegen.
Ich blute Sperma aus. Hinter dicken Theatervorhängen. Es hat nichts reales.
Das Theater ist vorbei. Der Vorhang gefallen.
Tosender Applaus.
Für wen?
Der Pfarrer. Der Pfarrer war’s.
Der Pfarrer. Der Pfarrer war’s. Mehr konnte er nicht sagen. Da brach er schon weinend zusammen. Es war furchtbar. Das hatte ich doch gar nicht gewollt. Ich habe doch nur eine Frage gestellt.
Er trank wieder. Und spritzte sich das Zeug.
Er trank wieder. Und spritzte sich das Zeug. Nicht weil er es wollte. Sondern weil es nicht anders ging. Erklären konnte er das keinem. Nicht seinem Kumpel, nicht seiner Frau. Erst recht nicht seinem Kind. Der wurde langsam groß, wollte selber in den Sport, erfolgreich werden, dem Vater nacheifern. Und der Vater verweigerte es ihm. Natürlich konnte sein Kind das nicht verstehen. Wie sollte er auch. Also stand er als guter Vater am Spielfeldrand. Und applaudierte. Und trank. Und spritzte sich, in den Pausen, in der Toilette. Im Stadion. Der Geruch schon nur, untertag. Die Matten, der Staub, der Dreck. Die Räume, die sich kaum geändert hatten. Er trank. Er konnte nicht anders. Das Spritzen, das schnitt er nicht mehr mit. Er wusste es, und wusste es nicht. Wenn seine Frau ihn fragte, leugnete er. Nein, er leugnete nicht, er wusste es nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe doch jetzt dich, und unsern Sohn. Da kann ich doch nicht. Nein, mit Drogen, mit Drogen habe ich nichts mehr am Hut. Bis er liegen blieb. Und zu erzählen begann. Von all den Jahren im Leistungssport. Und den Matten, in den dunklen Ecken. Auf die man sich legen konnte. Auf die er gelegt werden konnte. In allen Positionen. Und nie gesprochen hätte. Er wollte doch Erfolg haben. Und keine Freunde verlieren.
Danke.
Um Mitternacht, nach einem Bier, finde ich die Texte gut. MEINE Texte. Ich habe zurückgelesen. Im Blog. Über die Tage rückwärts. Was ich mir in der Regel verbiete. Und zurzeit, zurzeit schreibe ich nicht mal mehr den Blog. Ich schreibe nicht mehr. Seit vielen Jahren zum ersten Mal schreibe ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Und vermisse es nicht. Und staue in mir Dinge an. Und explodiere fast. Und vermisse es trotzdem nicht. Dieses Schreiben. Das so anstrengend ist. Und zurzeit nicht mehr gelingen will. Ich weiß nicht wieso. Corona ist mir zu einfach. Als Erklärung, meine ich. „Schreiben, als müsste ich niemandem etwas beweisen.“ Jutta Reichelt erwähnt Dinge, die mich ansprechen, immer mal wieder. In diesen Tagen hänge ich manchmal auf Blogs ab. Von Jutta. Oder Austin Kleon. Von Leuten, die noch was tun, die noch schreiben, die noch online sind. Mit Dingen. Mit neuen Dingen. Mit Anregungen. Mit Tipps und Hilfen. Ja, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Bitte, helft mir! aber wer. ich weiß es nicht. Ich schreibe, mit Anregungen von andern. Wie vor fünfzehn Jahren, als ich nach Berlin kam, zum Schreiben, und ganz existenziell angewiesen war auf Gruppen, auf Anregungen, auf andere. Heute habe ich mir Schlagzeugvideos angesehen, für Kinder, den „Abwasch“ zum Beispiel. Seither kann ich schreiben. Für ein paar Minuten. Ich bin allen dankbar, die sich noch rühren, die sich noch raustrauen, wenn auch online, und ihre Kunst zeigen, ihre Musik, ihren Text, ihre Ideen, ihre Wünsche und Träume. Weil ich mich dann wieder bewegen kann, für Minuten. Wenn ich ihnen zuhöre. Und zu-lese. Und zu-fühle. DANKE.
Warten.
Er wartet. Den ganzen Tag. Er hat ihr diesen Brief geschrieben. Keinen Brief, eine E-Mail. Immerhin mehr als eine SMS. Eigentlich gilt das ja schon als Brief. Einen richtig richtigen Brief, das macht doch keiner mehr. Also auch er nicht. Obwohl er es sich überlegt hatte, das schon. Aber nein: eine lange E-Mail, klar formuliert, zwei Nächte lang drübergesessen. Vielleicht zwei Stunden zu lang, kann schon sein, gegen Ende hat er Dinge gelöscht und Sätze eingefügt, die vorher vielleicht besser gewesen wären. Aber das kann er jetzt nicht mehr ändern, senden hat er leider noch in der Nacht gedrückt. Vielleicht doch lieber einen Brief schreiben, beim nächsten Mal. Naja, wer weiß, vielleicht wäre er auch mitten in der Nacht noch losgelaufen, zum Kasten, und aus dem Kasten holen, das ging ja auch nicht. Die E-Mail war jetzt wenigstens sofort bei ihr, nicht erst irgendwann, wenn die Post es geschafft haben würde, trotz dieser seltsamen Zeiten mit Schichtdienst bei den Postbeamten. Die Mail war in ihrer Inbox, vielleicht hat sie sie schon gelesen, vielleicht brütet sie schon über einer Antwort, wer weiß. Er jedenfalls, er kann jetzt nichts mehr tun. Gar nichts mehr. Er hängt vor dem Computer rum, schaut sich Nachrichten an und klickt alle paar Minuten in die Mails, obwohl doch eine Benachrichtigung aufploppt, sobald eine neue ankommt. Er prüft dennoch nach, ob sie nicht vielleicht doch schon geantwortet hat, ob er nicht vielleicht ein aufgeplopptes Fensterchen verpasst hat. Kein guter Tag, das spürt er schon. Draußen scheint die Sonne, er kann sich nicht überwinden, rauszugehen. Er könnte ja ihre Antwort verpassen. Und vielleicht muss er dann ja sofort reagieren oder anrufen oder rübergehen. Das darf er sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn sie erst morgen antwortet? Oder in einer Woche? / Oder gar nicht? /
gute Momente.
Heute hat ihr eine Nachbarin geschrieben. Und ihr Mann hat ihre Hand gehalten, beim Spazierengehen. Der Kaffee war lecker, die Zimtschnecke süß und klebrig. Der Wind hat die Wolken weggepustet, jetzt ist der Himmel blau, die Sonne scheint, ein paar letzte Herbstfarben. Der Wind hat ihr den Kopf leer gepustet, es liegen nicht mehr so viele Nachrichten quer, weder Weltpolitik noch Corona. Sie fühlt sich frei, so frei, dass sie sich hinsetzen kann und schreiben.
Die Augen hinausgehen lassen, in den blauen Himmel. Gerade noch war sie doch leer gepustet gewesen. So leer, dass sie sogar hatte schreiben können. Das war ein guter Moment gewesen. Ein sehr guter sogar.
ohne Titel.
Die Form der Isolation hat sie auf alte Zustände zurückgeworfen, die sie überwunden glaubte, für vielleicht immer.
ich kann essen. aber nicht schreiben.
ich kann essen. aber nicht schreiben. ich kann noch mehr essen. aber nicht schreiben. ich kann Tee trinken. aber nicht schreiben. ich kann Wein trinken. aber nicht schreiben.
Natürlich kann sie schreiben. Sie muss sich nur hinsetzen.
(Wieso ist dieses „sich hinsetzen“ zurzeit soviel schwieriger.)
ohne Titel
Er wird sich wieder fernhalten, von den Menschen. Dafür sind die Zeiten sehr geeignet.
ausquartiert.
Nicht lesen, vor allem keine Nachrichten. Er wollte sich doch fernhalten. Und wusste nicht, was er stattdessen tun könnte, jetzt, da er wieder allein war. Vor zwei Wochen hatte er sich bei den Nachbarn einquartiert, mit einer faulen Ausrede. Dass sie faul war, konnten diese ja nicht wissen. Seine Nachbarn waren freundlich und hatten ihn auch schon zum Kaffee eingeladen. Er wusste, dass sie ein Gästezimmer hatten, da ab und zu Freunde bei ihnen übernachteten, dann auch mal abends und nachts lange laute Musik war, Partystimmung, was verboten war. So hatte er zwei drei Bemerkungen eingeflochten, damit sie wissen sollten, dass er sie auch anzeigen könnte. Und dann sein Problem geschildert, mit dem Wasserrohrbruch und dem Fenster, und bis das repariert sei, ob er nicht vielleicht bei ihnen wohnen könnte, vorübergehend, eine Woche höchstens, weil bei ihm Tag und Nacht der Bautrockner laufe, laut sei der und stinke, und das Fenster immer offen, trotz der Kälte, damit alles abtrocknen kann, undsoweiter. Die beiden waren freundlich, auch wenn sie nicht sonderlich erfreut wirkten. Ja, so zwei drei Tage sei das sicher kein Problem, danach müsse man sehen. Gestern hatten sie ihn nun rausgeworfen, nach zwei Wochen. Mit einer Ausrede, das wusste er bereits. Ihre Freunde hätten keine andere Bleibe, es sei wichtig, die würden morgen kommen. Heute früh war er somit wieder zu sich gezogen, aus ihrer warmen gemütlichen Küche ausgezogen, in seine eigene Kälte sozusagen. Ungeheizt war es, das stimmte, aber nicht feucht, das zum Glück nicht. Auch kein Bautrockner, kein Lärm. Bei den Nachbarn allerdings auch nicht. Keine Party, keine ankommenden Gäste. Da wusste er, dass sie ihn angeschwindelt hatten. Um ihn loszuwerden. Sie wollten ihn nicht mehr. So ganz konnte er das ja nicht verstehen, er war doch leise und freundlich gewesen, hatte manchmal für die beiden gekocht und ganz von sich aus das Bad geputzt. Aber scheinbar war es nicht genug gewesen. Er wusste nicht, was er sonst noch hätte anbieten können.
Ein Kind verlieren. Es wiederfinden.
Ein Kind verlieren. Es wiederfinden. Er hatte immer gehofft, sie irgendwann nochmals wieder zu sehen. Irgendwann.
Bußgeldkatalog
Ich habe mir den Bussgeldkatalog zur Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen angesehen. Seither weiß ich, wieviel ich bezahlen muss, weil ich heute meine Nachbarn umarmt habe. Seither weiß ich, wieviel ich bezahlen muss, wenn ich morgen auf dem Spielplatz in der Nähe von mehr als einer anderen Familie stehe. Seither habe ich das Gefühl, mich nicht mehr bewegen zu dürfen, nicht mehr atmen zu können. Ich habe keine Ahnung, wie hilfreich die Maßnahmen für die Handhabbarkeit der Pandemie sind. Ich weiß nur, dass sie in meinem Nervensystem Dinge anrichten, die nahe an nicht mehr handhabbar sind. Und dass ich auf die paar letzten Umarmungen im Umfeld nicht verzichten kann, aus gesundheitlichen Gründen!, auch wenn ich mich strafbar mache. Mich strafbar zu machen mit solch existenziellen Bedürfnissen – ich weiß nicht, was ich dazu schreiben könnte. Außer, dass es mir zunehmend schwer fällt, zu schreiben.
sie hat sich angefasst.
sie hat sich angefasst. auf dem Sofa. unter der Decke. hinter zugezogenem Vorhang. man tut das nicht. in ihrem Alter schon gar nicht.
sie hat sich angefasst. das war gut.
Signore B.
Die kleine Buchhandlung in der Altstadt, ein Antiquariat. Ein alter Mann mit italienischem Namen, in Bern geboren zu einer Zeit, in welcher es noch schwer gewesen war, Italiener als Eltern zu haben. Er hat eine Lehrstelle erhalten, in der Buchhandlung, die er später übernommen hat, und nicht mehr verlassen, bis zu dem schwarz umrandeten Schild im Schaufenster, wegen Todesfall geschlossen. Die hohen Regale noch bis zur Decke vollgestopft mit wunderbarsten Schätzen, neuen und alten, eine wilde wunderbare Mischung. Eine Woche später schon waren die Regale leer. Danach wurde herausgerissen, grundsaniert, Schaufenster erneuert und die alte morsche Ladentür ersetzt, durch welche der Wind gezogen hatte, bei jedem Wetter. Fast täglich bin ich vorbeigegangen, vor dem Laden stehen geblieben, in jenem Januar. Meine Form des Abschiednehmens. Ich wusste nicht, wann und wo er beerdigt wurde, der alte Herr, ob überhaupt, er hatte keine Familie. Am Schluß hat er im Laden geschlafen. Wie er gestorben ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, dass er sich spät am Abend mit der hohen Leiter vorsichtig vorsichtig noch einen kostbaren alten Band von ganz oben heruntergeholt hat. Den Staub weggepustet, noch oben auf der Leiter, und unten mit dem Pinsel nochmals sorgfältig abgestaubt. Dass er sich einen letzten schwarzen Tee gekocht hat, er hat immer schwarzen Tee getrunken, aus einer schweren schwarzen gusseisernen Kanne, die Tasse innen fast ebenso schwarz. Dass er sich in den großen gemütlichen Ohrensessel gesetzt hat, in dem ich selber so viele viele Stunden verbracht habe. Und mit Tee und Buch friedlich eingeschlafen ist.
Danke, Signore B., verspätet. Für Zeit und Raum, Ruhe und Weisheit, Sessel und Bücher, Bücher Bücher Bücher.
am See
Ich liege auf einem Baum, am See, in der Sonne. Den Körper eingeschmiegt in die Formen des Astes, der weit über das Wasser reicht. Der Wind trägt die letzten gelben Blätter über mich, über den See, über den Herbst, die Zeit, die Sorgen. Bis keine Sorgen mehr übrig sind. Nur noch Wind und Blätter, Sonne und See.
Mein Lieblingsplatz, als Kind. Ich weiß nicht, ob der Baum noch steht. Wie oft lagsaß ich mit einem Buch und Heft und Stift in der Astgabel, die Beine gegen den Himmel am Stamm, den Körper ausgebreitet über dem Wasser, auf Buchenast und Buchenrinde, im Sommer im Winter, im Frühling im Herbst, keine Jahreszeit habe ich ausgelassen auf meinem Baum. Mein ganz eigener Platz. In all den Jahren hat sich nie jemand anderes zu diesem Baum verirrt, nur zu Fuß durchs Gestrüpp zu erreichen, in der Höhle unter den Wurzeln hauste der Fuchs mit seinen Jungen. Ein Ort wie aus einem Buch.
ohne Titel.
Dem Mann die überstehenden Haare weggeschnitten, neben dem Ohr. Die kleinen kurzen Härchen vom Ohr gepustet. Danach war wieder Schluss mit Intimität.
Diese feinen Härchen.
Diese feinen Härchen. Babyhaare, Greisenhärchen. Die Zeiten überlappen sich. Die letzte Nacht von Großmutter. Die ersten Nächte mit dem Baby. Die späteren ins Bett bringen Zeiten, kleine Kinder, sehr kleine Kinder, ewas größere Kinder. Die Haare verknotet, voller Marmelade, mit einer Weigerung fürs Kämmen, fürs Haarewaschen. Heute sind Teller geflogen, Scherben in der Küche, im Flur. Sie weiß nicht mehr, wie es war, mit den Babyhaaren. Die Zeiten scheinen so wenig miteinander gemein zu haben. Wohin mit dem Kind, das wütet und tobt, Dinge zerreisst und zerschmeisst, die liebsten Menschen beschimpft mit ärgsten Worten, deren Bedeutung das Kind noch nicht mal kennt, die liebsten Menschen bedroht, mit Gegenständen, mit Fäusten, mit Tellern und Gläsern. Mit purer Lautstärke. Manchmal weiß sie nicht mehr wohin mit sich. Mit dem Brüllen in ihrem Hals, das sie heiser werden lässt, also hat sie tatsächlich gebrüllt, und nicht zu knapp wahrscheinlich. Bedroht von fliegenden Tellern, schneidet sie kaum noch etwas mit, weder die Not des Kindes, noch ihre eigene.
Sie hat das Kind ins Bett gebracht. Die Haare gestreichelt. Sich an Babyhaare erinnert. An Großmutters Greisenhärchen, in ihrer Todesnacht. An ihre eigenen Haare, durchzogen von grau, als würde sie weiß in diesen Wochen. Sie hat die Haare gestreichelt, von ihrem Kind. Die Wangen, die Hände. Und sich kaum noch vorstellen können, was vormittags war. Wie ausgelöscht, schon fast vergessen.
Sie öffnet die Balkontür, eine Doppelfenster-Flügeltür, jede Menge Riegel zu öffnen. Sie tritt hinaus, zu den langsam eintrocknenden Blumen, den letzten Astern in voller Blüte, den Sternen am Himmel, den letzten Flugzeugen vom Flughafen Tegel. Manche Dinge verändern sich über Nacht.
Wein getrunken.
Wein getrunken. Bücher gelesen. Am Buch geschrieben. Sexueller Missbrauch. Zur Anzeige gebracht. Und das Gericht schreibt die Adresse auf den Beschluss. Wie kann das sein. Und es geschieht. Immer wieder. Über Jahre Jahrzehnte sich abgeschottet, gesichert, alle Umzüge mit Sperrvermerken und ohne Mitteilung an niemanden. Die Anzeige, kurz vor der Verjährung, weil es ihr wichtig war, die Dinge zur Anzeige zu bringen, dass nicht noch mehr geschieht, mit denselben Männern. Die Anwältin, der Gutachter, die Zeugen, alle verschlüsseln die Namen, die Wohnorte, die Städte. Aber das Gericht, das Gericht schreibt die Adresse auf den Beschluss. Der Gerichtsentscheid geht in mehrfacher Ausführung an alle Beteiligten. Auch an die Angeklagten, die mit Bewährungsstrafen davonkommen, weil nach Jahrzehnten kaum noch etwas nachzuweisen, Aussage gegen Aussage, kaum verlässliche Zeugen. Ein klassischer Fall. Bewährungsstrafe heisst, die Männer bleiben auf freiem Fuß. Und sind wütend, weil sie vor Gericht gezogen wurden, nun vielleicht selber umziehen müssen, in manchen Kreisen an Ansehen verlieren, auch wenn sie in andern Kreisen hinwiederum sogar an Ansehen gewonnen haben. Wütend sind sie dennoch. Und erhalten vom Gericht auf dem Urteil die Adresse geliefert. Von der nun erwachsenen Frau, die sie vor Gericht gezerrt hat. Undsoweiter. Die Folgen lassen sich ausrechnen. Sie will nicht mehr rechnen. Sie schließt ihr Heft, sie will nicht mehr schreiben. Sie legt die Bücher zur Seite, sie will nicht mal mehr lesen. Sie gießt sich Wein ein, öffnet eine nächste Flasche. Sie will nicht schlafen, schlafen ist ihr zu gefährlich, in diesem Zustand. Manchmal können ein paar Flaschen Wein auch hilfreich sein. Sie weiß, dass es keine Dauerlösung sein darf. Aber für heute, für heute ist es ok.
Lachen.
Lachen. Ich möchte lachen.
Erstaunlicherweise lache ich häufiger als üblich, in diesen Tagen.
Nachrichten lesen.
Nachrichten lesen. Und dann gar nichts mehr können. Nicht mehr atmen. Nicht mehr lesen. Nicht mehr schreiben. Nicht mehr denken. Er rief seinen Neffen an, mit dem hatte er sich immer gut verstanden, sie waren in vielem einer Meinung, auch Corona und politisch. Seine Frau teilte ihm mit, dass er auf der Intensivstation liege und sie ihn mit den Kindern nicht mal mehr besuchen dürfe. Es sieht nicht gut aus. Er setzt sich hin und nimmt sich die Nachrichten nochmals vor. Die Wahlen in den USA. Die Corona-Maßnahmen. Der Terror in Wien. Und andernorts. Und hier. In seinem Gehirn. In seinem Gedärm. Er setzt sich auf Toilette. Und lässt es hinausschießen. In Strahlen. Schwallweise. Seit den Nachrichten der letzten Tage kommt er kaum noch vom Klo herunter. Heute ist ihm zum ersten mal schlecht. So richtig schlecht. Und er wollte doch gar nicht brechen, heute. Er wollte mit seinem Neffen telefonieren. Sich kurzschließen, mit einem Verbündeten. Nicht mehr allein sein und verloren. Und nun auch dieser. Wie soll er das aushalten. Falls der das nicht überleben sollte. Nein. Gar nicht daran denken. Aber woran dann. An die Nachrichten durfte er auch nicht denken. An seinen Sohn auch nicht, dem ging es weiterhin schlecht, der war jetzt in der Geschlossenen, würde da wohl auch noch eine Weile bleiben. Er ging ihn nicht besuchen, was sollte er ihm auch sagen, von der Welt auf der anderen Seite der Gitterfenster. Es gab gerade nicht so viel Gutes zu erzählen. Und seine Ex-Frau? Die Mutter seines Sohnes? Vielleicht sollte er seine Ex-Frau anrufen. Seit der Sohn volljährig geworden war, gab es keinen Kontakt mehr zwischen ihnen. Sie würde ihn verstehen, sie kannte ihn, er wäre nicht mehr ganz so allein. Aber sie hatte Vorerkrankungen. Risikogruppe. Was, wenn von der Seite jetzt auch noch eine Hiobsbotschaft kam. Plötzlich steckte er mitten in der Bibel. Hiob. Mitten in der Kindheit. Mitten in der Kirche. Wenn er sich verneigen könnte, vor einem Kreuz. Es gab kein Kreuz mehr, nicht für ihn. In dieser Nacht, heute, weiß er nicht, ob er weiterleben kann. Bitte helft ihm. Wo immer ihr ihm begegnet.
Ein Kind wird geboren.
Ein kleines Kind wird geboren. Die Oma steht auf der Matte. Noch am selben Tag. Und will das Kind in den Arm. Die Mutter weigert sich. Die Tante steht vor der Tür. Am nächsten Tag. Und möchte Kaffee trinken. Das Kind auf den Arm. Ein Stück Kuchen am liebsten. Dass keine Zeit bleibt zum Kuchenbacken, direkt nach der Geburt, das ist manchen nicht ganz klar. Dass die Mutter nur im Bett liegen sollte, zwei Wochen lang, hat man früher gesagt, wenn sie je wieder so richtig auf dem Feld soll arbeiten können. Im Bett liegen. Halb abgedunkelt. Bitte ohne Schwiegermutter, ohne Schwester, ohne Schwägerin. Am liebsten sogar ohne Mann. Ohne Kind? Sie weiß es nicht. Sie dachte, sie wird es lieben, vom ersten Moment an. Sie ist so müde. Sie ist so grau und dumpf. Das Kind trinkt, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Ihre Nippel sind wund. Ihr Innerstes ist wund. Alles schmerzt. Wie soll sie so lieben. Und dennoch. Sie will dieses Kind nicht hergeben. Wer immer da steht. Mitten im Zimmer. Im Flur. In der Küche. Vor der Wohnungstür. Sie lässt keinen bis zum Kind. Nicht mal den Vater. Das Kind gehört erst mal ihr. Und dann an ihre Brust. Alles andere würden sie sehen. Später.
Heute ist eine Frau dabei.
Ein Müllauto steht vor dem Haus. Die kleinen Kinder bleiben stehen, winken den Müllmännern. Meistens sind es Männer. Heute ist eine Frau dabei. Sie wirkt wie eine Frau, obwohl sie in denselben Klamotten steckt wie die andern. Blonde Haare mit herrlichen Locken, ein fester runder Busen. Ein großes Gesicht, das Mann wie Frau sein könnte. Eine schlanke Gestalt, die aber groß ist und nach sehr viel Kraft aussieht. Die Männer winken in der Regel zurück, wenn Kinder am Rand stehen. Die Frau winkt nicht. Sie lächelt nicht mal. Sie macht ihren Job, holt die Mülltonnen aus den Häusern, rollt sie zwischen den geparkten Autos auf die Straße, schiebt sie den Männern zu, die sie am Müllauto einhaken und hochheben lassen. Die Frau rollt die leeren Tonnen wieder zurück, sie klingen jetzt anders. Die Türen zu den Müllräumen fallen zu. Sie läuft dem Müllauto hinterher, mit einem wiegenden Schritt, der wieder Mann wie Frau sein könnte. Auf dem Gesicht immer noch keine Spur von Regung. Nicht nur kein Lächeln. Nein, keine einzige Spur von Mimik. Als wäre das Gesicht eine Maske. Eine schöne Maske. Eine perfekte Maske. Und doch werden die Kinder leise und ehrfürchtig, fast ängstlich. Keines der Kinder winkt mehr. Keines lacht. Nun lächeln auch die Männer nicht mehr.
Ein Buch lesen.
Sie las, um sich nicht mehr zu fühlen. Sie las, um nicht mehr zu denken. Sie las, um nicht mehr zu trauern. Sie las neben spielenden Kindern, weil sie die spielenden Kinder nicht mehr ertragen konnte. Sie las abends, um nicht mehr einschlafen zu müssen. Sie las nachts, um nicht zu träumen. Sie las tagsüber, um nicht zu arbeiten. Sie las, um nicht aufräumen zu müssen, nicht zu putzen, nicht zu kochen. Sie las, um nicht mehr essen zu müssen. Sie brachte die Kinder ins Bett, mit einem Buch in der Hand. Sie hielt Kinderhände und sang Kinderlieder, mit den Augen an den Zeilen. Sie trank Kaffee, mit ihrem Mann, und las. Sie sprach mit ihrem Mann, ohne das Lesen zu unterbrechen. Sie organisierte den Tag der Kinder, die Spielverabredungen, die Termine ihres Mannes, ohne aufzuhören, innerlich die zuletzt gelesenen Sätze zu wiederholen und die nächst zu lesenden sich bereits vorzustellen. So las sie doppelt und dreifach so schnell wie andere, die Zukunft bereits im Blick, das Ende schon quergelesen. Bücher waren nie zu Ende, sie konnte sie später wieder aus dem Regal ziehen und ein zweites Mal lesen, ein drittes. Und manchmal wusste sie erst auf den letzten Seiten, ob sie das Buch nicht doch vielleicht schon mal gelesen hatte. Ganz sicher war sie sich nie. Kaum ein Satz blieb in ihr hängen. Und doch las sie weiter. Sie legte die Bücher nicht mehr aus der Hand. Nicht mal in den seltenen Momenten des Schlafs, der sie überraschte, mitten im Satz, für halbe Stunden. Was würde sie tun, ohne ein Buch. Sie wusste es nicht.
Er lachte. Leise, in ihre Haare hinein.
Sie saß alleine am Küchentisch, ein Glas Rotwein vor sich, die Flasche auf der Küchenablage. Kein Buch, kein Heft, nichts. Ein Blick durchs Fenster in die Nacht. In die Leere. Ein Glas Rotwein nach dem andern. Der Mann verreist, mit den Kindern. Alleinsein hat sie noch nie gut vertragen. Obwohl sie gerne öfter allein wäre.
Plötzlich fühlt sie sich beobachtet. Als würde jemand durch den Briefkastenschlitz in der Tür hindurchsehen. Sie hatte ihn schon lange mal verkleben wollen, von innen. Keiner warf mehr Post durch den Schlitz, die Briefkästen standen im Hof. Und nun die Geräusche an der Tür, als würde einer dort knien und seinen Kopf anlehnen. Sie fühlte seine Augen im Rücken.
Seine. Es war keine Frage für sie. Sie wusste nicht, wer es war. Aber ein Mann, da war sie sich sicher. Sie stand auf und ging zum Türspion, sah hinunter auf diesen knienden Mann, es war der Nachbar von nebenan, sie hatte ihn lange nicht gesehen. Obwohl er ihre Beine jetzt direkt vor Augen haben musste, stand er nicht auf. Da öffnete sie die Tür.
Sie öffnete ihm die Tür, als wäre er ein erwarteter Gast. Er fiel vorwärts in ihre Wohnung, als wäre er schwer verletzt. Sie half ihm aufstehen, da waren sie schon Hand in Hand. Sie goss ihm Wein ein, da stand er hinter ihr, die Hände an ihren Hüften. Hier kann uns jeder sehen, er sah aus dem Fenster, auf die Straße. Sie nickte. Er griff ihr an die Brust, sie wehrte sich nicht.
Sie sagte, ich könnte schwanger werden. Er lachte. Leise, in ihre Haare hinein. Ja, ich hätte gerne ein Kind von mir bei euch. Ich würde es ab und zu besuchen. Sie zögerte. Wirst du dann bei uns einziehen? Er schüttelte den Kopf. Sie spürte es, in ihren Haaren.
Sie trank den Wein aus seinem Glas, das er ihr an die Lippen hielt. In diesen Zeiten war es verboten, ein Glas zu teilen, unter Haushaltsfremden. Aber sie waren keine Haushaltsfremden mehr. Sie würden ein Kind zusammen haben.
Ein letztes Mal Kaffee trinken gehen.
Ein letztes Mal Kaffee trinken gehen. Für lange Zeit. Wie lange, das weiß sie nicht. Den vier Wochen traut sie jedenfalls nicht. Und auch vier Wochen sind bereits lang. Gemeinsam Kaffee trinken gehen, das gehört zu den Ritualen von ihr und ihrem Mann. Einmal die Woche, das schaffen sie, neben ihren vollen Tagen. Jede Woche, fast jede Woche. Die zwei Stunden, die sind wichtig. Manchmal machen diese zwei gemeinsamen Stunden den Unterschied, wie sich die Woche anfühlt, wie oft sie streiten, wie oft sie die Kinder anpampen, mit ihnen schimpfen, auch mal brüllen. Nun werden sie nur noch spazieren gehen, ohne Kaffee. Und wenn es regnet und dunkel und neblig bleibt, wie so oft, im November, werden sie am Computer sitzen bleiben, statt gemeinsam unterwegs zu sein. Das wird ihnen nicht gut tun, sie weiß das schon.
Heute sitzen sie bei Frau Krüger. Frau Krüger, die schafft es, ihre gute Laune zu bewahren. Sie wird wieder nur am Fenster verkaufen, wochenlang, außer Haus Verkauf ist noch gestattet. Und sie ist gut gelaunt und lacht und verliert ihren Humor nicht. Die beiden werden selber wieder fröhlicher, obwohl sie heute nicht sehr fröhlich hergekommen sind. Zum Schluss bedanken sie sich, für all die Stunden, die sie schon bei Frau Krüger im Kaffee verbracht haben, und für ihr Lachen, ihre Freundlichkeit, die gute Laune. Frau Krüger freut sich. Sie sagt: Wisst ihr, für diese gute Laune entscheide ich mich jeden Morgen aufs Neue. Weil es mir dann einfach besser geht. Man macht sich ein bisschen was vor. Aber mir geht es besser damit. Und den meisten, die hier reinkommen und wieder rausgehen, denen geht es nachher auch besser.
Die beiden fassen sich an den Händen, Mann und Frau, laufen durch den Kiez, im Sonnenschein. Sie können die Herbstluft wieder riechen, die farbigen Blätter sehen, den Wind im Gesicht spüren, die unerwartete Kälte. Sie können sogar ein Stück die Liebe fühlen, die in diesen seltsamen Tagen manchmal sich zurückzieht hinter die Sorgen, die Wolken. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Vielleicht wird sie es einmal versuchen, am Morgen, beim Aufstehen. Sich für gute Laune zu entscheiden.
Das würde sie umbringen.
„Nein, weißt du, das würde sie umbringen.“ Mit dieser Antwort hatte er nicht gerechnet. Er hatte seine Mutter zu seiner Körpertherapeutin geschickt. Vordergründig wegen deren Rückenschmerzen. Hintergründig, weil er gehofft hatte, dass sie in ihr auch einen solch tiefgreifenden Wandel auslösen würde wie in ihm. Mit ihren Zauberhänden. Schließlich hatte er oft gedacht, wenn dieser steinharte Panzer rund um seine Mutter mal ins Wanken käme, dass dann noch alles wieder gut werden könnte. Und nun wollte seine Therapeutin nicht. Sie wollte gerne die Rückenschmerzen seiner Mutter lindern, aber tiefer gehen würde sie nicht. Sie konnte das spüren, ob es Spielräume gab für Veränderungen. Und bei seiner Mutter, da war sie sich sicher, da gab es diesen Spielraum nicht. Wenn seine Therapeutin zu tief in ihre Spannungen greifen würde, mit den Händen, würde seine Mutter nicht mehr wiederkommen und behaupten, dass die Therapie gegen die Rückenschmerzen nicht geholfen habe. So wie sie es bisher mit allen Therapeuten und Therapeutinnen getan hatte. Immer, wenn er dachte, jetzt kommt was in Bewegung, wie toll!, immer dann hat sie die Behandlung frustriert und mit viel Vorwurf und Beschuldigungen abgebrochen. Dass dies für sie überlebensnotwendig sein könnte, dass sie gar nicht anders konnte, das hatte er noch nie bedacht. Aber es leuchtete ihm sofort ein. Ja, es würde sie umbringen. Und nein, das wollte er ja auch nicht. Sollte sie doch hinter ihrem Panzer noch ein wenig leben. Eine Beziehung zu ihrem Sohn würde das dann wohl somit doch nicht mehr werden. Aber nachdem seine Therapeutin ihm diese überraschende Antwort gegeben hatte, konnte er besser damit leben.
Bist du verrückt?
„So viel?!? Bist du verrückt!?“ – Nein, er war nicht verrückt, im Gegenteil. Er war so viel weniger verrückt als all die Jahre davor. Er stand sogar finanziell auf fast stabilen Beinen, das hatte es noch nie gegeben.
Es war ihm ein Anliegen gewesen, zu spenden. Es hatte sich gut angefühlt. Ein Geschenk, mehr an sich als an den andern. Es hatte nichts mit überheblich zu tun, größer stärker weiter, mir geht es besser und ich zeige es dir. Nein. Es hatte mit dem Geben-Können zu tun, mit dieser Möglichkeit. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er mehr als für die pure Existenz, das nackte knappe Überleben. Und was sollte er mit dem Geld? Es anhäufen? Das war die Tradition der Eltern und Großeltern, ihm war das Anhäufen suspekt. Es fühlte sich nicht gut an, es machte ihn weder glücklich noch zufrieden. Diese Überweisung dagegen, die hatte ihn zufrieden gemacht. Fast glücklich.
Sie kann das.
Sie kann das. Sie weiß das. Sie weiß das schon lange. Sie konnte das schon immer, sie hat schon als Kind gesungen. Sie hat auch bereits als Kind gewusst, dass sie singen kann, dass sie gut singt. Oder vielleicht hatte sie es als Kind zum letzten Mal gewusst. Bevor alles andere kam. Nicht gut genug, nicht schön genug, nicht ganz richtig so, andere können besser. Nicht stabil genug, für den Beruf, noch nicht mal für die Ausbildung.
undsoweiter.
Sie versucht, sich dieses Gefühl wieder herzuholen. Wie es gewesen war, zu singen, mit innerster tiefster unzweifelhafter Sicherheit, dass sie wunderschön sang, dass alle zuhörten, dass alle lächelten und sich freuten. Alle.
nur Mutter nicht.
Sie hört dieses Nörgeln, dieses Unzufriedensein, die ständige Kritik, nie gut genug. Ohne ein Lächeln, ohne ein Zeichen des Liebhabens. Sie hört es deutlich und genau, als säße die Mutter hinter ihr, harte Holzbänke, Kirche, und das leise Zischen, das mahnende Raunen, der Tritt unter der Bank hindurch.
Sie hatte das gekonnt, als Kind. Singen. Sie hatte nie in Frage gestellt, dass sie singen würde. Auf der Bühne, als Sängerin. Dass sie berühmt werden würde. Und glücklich. Und zufrieden.
Mutter war lange schon tot. Es wurde Zeit, dass sie wieder zu singen begann. Auch wenn es vielleicht dauern würde, ihre Stimme wieder auszugraben. Und sie nicht mehr ganz gleich klingen würde, jetzt, mit siebzig.
Sie stand auf, aus dem Bett, zum ersten Mal seit vielen Tagen. Stellte sich hinaus, auf den Balkon. Und begann zu singen. Öffentlich. Quer über den Platz. Sie hatte sich lange nicht mehr so gut gefühlt. Als könnte sie nochmals zu leben beginnen.
Freiheit(en).
Wir sind unterwegs, im Bus, in Brandenburg. Wir dürften sogar übernachten. Nach Freiheit fühlt es sich trotzdem nicht an. Vorgestern war es noch verboten. Und wie es nächste Woche wird, weiß keiner. Sosehr haben mich die Maßnahmen schon zermürbt, dass ich die Freiheiten nicht mehr als Freiheiten wahrnehme.
Es geht wieder los.
Es geht wieder los. Wir dürfen nicht mehr ins Umland, mit unserem Bus. Nirgends mehr übernachten, auch nicht einsam und allein im Wald. Wir könnten die Rehe anstecken, in Brandenburg, in Mecklenburg, die Möwen am Meer. Wir dürfen nicht. Wir sind Risikogebiet. Wir. Und gleich ein Kollektiv. Ich fühle mich nicht als Kollektiv. Ich bin nicht Risiko. Im Gegenteil. Ich habe meine Praxis wieder offen, ich begleite Menschen, denen es nicht gut geht, denen es in solchen Zeiten noch weniger gut geht. Ich bin kein Risiko. Ich will nicht Risiko sein. Ich will nicht, dass Menschen, die auf einem Gehweg an mir vorbeigehen (müssen), wegsehen, den Atem anhalten, sich abwenden, weil sie sich anstecken könnten. All diese fehlenden Augenkontakte, all diese fehlenden kleinen tagsüber Lächeln, die wir früher wie selbstverständlich eingesammelt haben, meine Kinder sowieso, ich wenn es mir gut ging. Keiner sieht sich mehr an. Risiko, man könnte sich anstecken. Wir bleiben nicht nur in der Stadt sitzen, gezwungenermaßen, auch in den Ferien, die Kinder zuhause. Wir bleiben auch auf den Gehwegen unter uns, atemlos, in uns drinnen eingesperrt.
‚adoptiert‘ – ein Interview
Über die Leseprobe zum Romanprojekt ‚adoptiert‘ hat mich die Redaktion der Fachzeitschrift für die Pflege- und Adoptivkinderhilfe PFAD angeschrieben. Sie hätten gerne das Buch rezensiert – das es allerdings noch nicht gibt. Wir haben stattdessen ein schriftliches Interview gemacht, das Ende August erschienen ist (PFAD, Jg. 34, Heft 3, Aug 2020, S. 13-15). Mit freundlicher Erlaubnis des Schulz-Kirchner Verlags darf ich das PDF des Interviews hier verlinken. Über Rückmeldungen freue ich mich.
Stiftungssuche – Romanprojekt ‚adoptiert‘
Das Romanprojekt ‚adoptiert‘ hat in den letzten Jahren zwei wichtige Förderungen erhalten. Für die Fertigstellung des Manuskripts suche ich aktuell wieder nach einer Finanzierung, mit der ich mir weiterhin ausreichend Zeit für die literarische Arbeit leisten kann. Falls Sie Kontakte zu Stiftungen und/oder Privatpersonen haben, die das Projekt finanziell (oder auch ideell und/oder inhaltlich) unterstützen könnten, freue ich mich über eine Nachricht!
‚adoptiert‘ erforscht die individuellen und gesellschaftlichen Folgen von innerfamiliärer und organisierter Gewalt an Kindern. Ein umfangreiches Großprojekt, das bereits ein paar Jahre in Arbeit ist. Vielen Dank an alle, die mich immer wieder ermutigen.
Buchprojekt Corona-Blog
Zugegeben, es wird wohl eher ein Heft werden. Aber immerhin. Ich habe mich entschieden, die Texte aus dem Corona-Blog (Mai-Juni 2020) lektorieren zu lassen und zu publizieren. Ab September hat meine Lektorin Zeit, ich freue mich darüber; Martina Laux, von Hause aus Übersetzerin, ist eine wunderbare Sprachkünstlerin, die sehr sorgsam mit meinen sprachlichen Eigen- und Besonderheiten umgeht. Die Gestaltung wird meine Cousine übernehmen, die bereits die wunderschönen Titelseiten meiner Leseproben gestaltet hat (die Leseproben gibt es übrigens auch gedruckt, sie können bei Interesse verschickt werden!).
Corona-Blog. Mai-Juni 2020.
Zwei Monate lang habe ich fast jeden Tag einen kleinen Text geschrieben und am nächsten oder übernächsten Tag online gestellt. Ein Corona-Blog, aus der Not geboren, weil ich die Kinder zuhause hatte, jeden Tag, und wie so viele andere zu gar nichts mehr kam.
Aber zehn Minuten? Nur zehn Minuten? Zehn Minuten müssten eigentlich drin liegen, auch jeden Tag. So ist in der Zeit des Lockdowns eine kleine Textsammlung entstanden, die gerne weiterhin gelesen werden kann. Hier geht es zu den Beiträgen im Corona-Blog.
Zugleich bin ich froh, mit der Wiedereröffnung der Kitas und Schulen wieder mehr Zeit für mich und meine Arbeit zu haben. Der Corona-Blog bleibt daher geschlossen. Stattdessen werde ich von Zeit zu Zeit aus meiner Arbeit berichten. Über Rückmeldungen, Fragen oder Anregungen per E-Mail freue ich mich.
Sommerpause
Heute Abend gehe ich offline.
Ich wünsche allen einen schönen Sommer. Wenn möglich einen kleinen Ortswechsel, er verändert die Perspektiven. Und bis im August wieder!
Wie ich Schriftstellerin wurde.
Ich habe das kleine Heft gelesen, von Jutta Reichelt. Wie ich Schriftstellerin wurde. Ein Corona-Sonderdruck, über den man sie in diesen schwierigen Zeiten ein wenig unterstützen kann. Ich hatte mir gleich zwei davon bestellt. Dann kam ein Paket mit zwei Heften und einem Buch. Die Rechnung lautete, wie bestellt, über zwei Hefte. Das Buch – war ein Geschenk! Ich hatte in Juttas Blog gelesen und kommentiert. Jutta hat in meinem Blog gelesen. Sie dachte, dass es da Berührungspunkte gibt. Und hat mir ihr Buch geschickt. Wiederholte Verdächtigungen. Ich habe es sehr sehr gerne gelesen. Und war verblüfft, über dieses Geschenk. Berührt. Wir kennen uns nicht. Wir haben ein paar Texte voneinander gelesen. Vielleicht werden wir uns kennen lernen, im nächsten Jahr. Ich freue mich darauf.
Ich arbeite wieder.
Ich arbeite wieder an ‚adoptiert‘. Ich bin froh darüber.
Wieder in Bewegung kam das Projekt über der Arbeit an einem Interview, das im Sommer in der PFAD Fachzeitschrift für die Pflege- und Adoptivkinderhilfe erscheinen wird. Ich habe in dem Interview erstmals Inhalte von Teil III für Außenstehende formuliert – seither setzt sich die Geschichte zusammen.
Eine erweiterte Inhaltsangabe zu ‚adoptiert‘ findet sich nun auch unter meinen Leseproben. Eine kleine Momentaufnahme aus der Geschichte von Sara gibt es im Blog-Text vom 19. Juni –
In vielen Kurztexten des Blogs scheinen sich Themen vorbereitet zu haben, die in den Roman gehören. Ich hätte das nicht gedacht. Der Blog war aus der Verzweiflung entstanden, weil ich neben den Kindern zuhause, geschlossenen Spielplätzen und fehlenden Freunden zu gar nichts mehr kam. Es sieht so aus, als hätte sich im Stillen und Geheimen doch so einiges getan.
Ein kleines Mädchen.
Ein kleines Mädchen mit einem blauen Tuch. Ihre Mama schlingt die Arme um das Kind. Es ist nicht die Mama. Es ist die Pflegemutter, die auf Wiedersehen sagt. Das Kind zieht woanders hin. Alleine.
Die Frau lässt los. Sie ist keine Mutter mehr. Der Vertrag endet. Heute.
Das Kind macht zwei drei Schritte. Dreht sich um. Will zurückgehen. Und weiß bereits, so klein sie ist, dass zurück nicht mehr geht, dass Mama nicht mehr Mama ist, dass es niemanden mehr gibt. Nur diese Frauen auf der anderen Seite des Raumes. Die für sie verantwortlich sind. Und sie zu den nächsten Eltern bringen werden. Heute noch.
Fortsetzung der Pause.
Der tägliche Corona-Blog wird weiterhin pausieren – der komplette LockDown ist vorbei, Ferienzeiten sind mit Kindern so oder so immer ein wenig anders und – ich habe es genossen, eine Woche offline zu sein.
In anderen Jahren habe ich mich im Sommer jeweils sechs bis acht Wochen aus dem Netz und allen Kommunikationswegen ausgeklinkt. Nach den langen Isolationswochen konnte ich mir dagegen kaum vorstellen, aus diesem täglichen online-Kontakt mit anderen wieder auszusteigen. Doch die offline-Tage an der Ostsee waren wohltuend – und überraschend produktiv. Ich habe so viel neuen Text geschrieben, wie seit Monaten nicht mehr. Das Arbeiten im Urlaub geschah wie nebenbei, auf Autofahrten, in Mittagschlafzeiten, im Strandkorb, neben spielenden Kindern.
Ab Samstag werde ich mich daher voraussichtlich für zwei drei Wochen ausklinken. Bis dahin gibt es noch den ein und anderen Text im Blog.