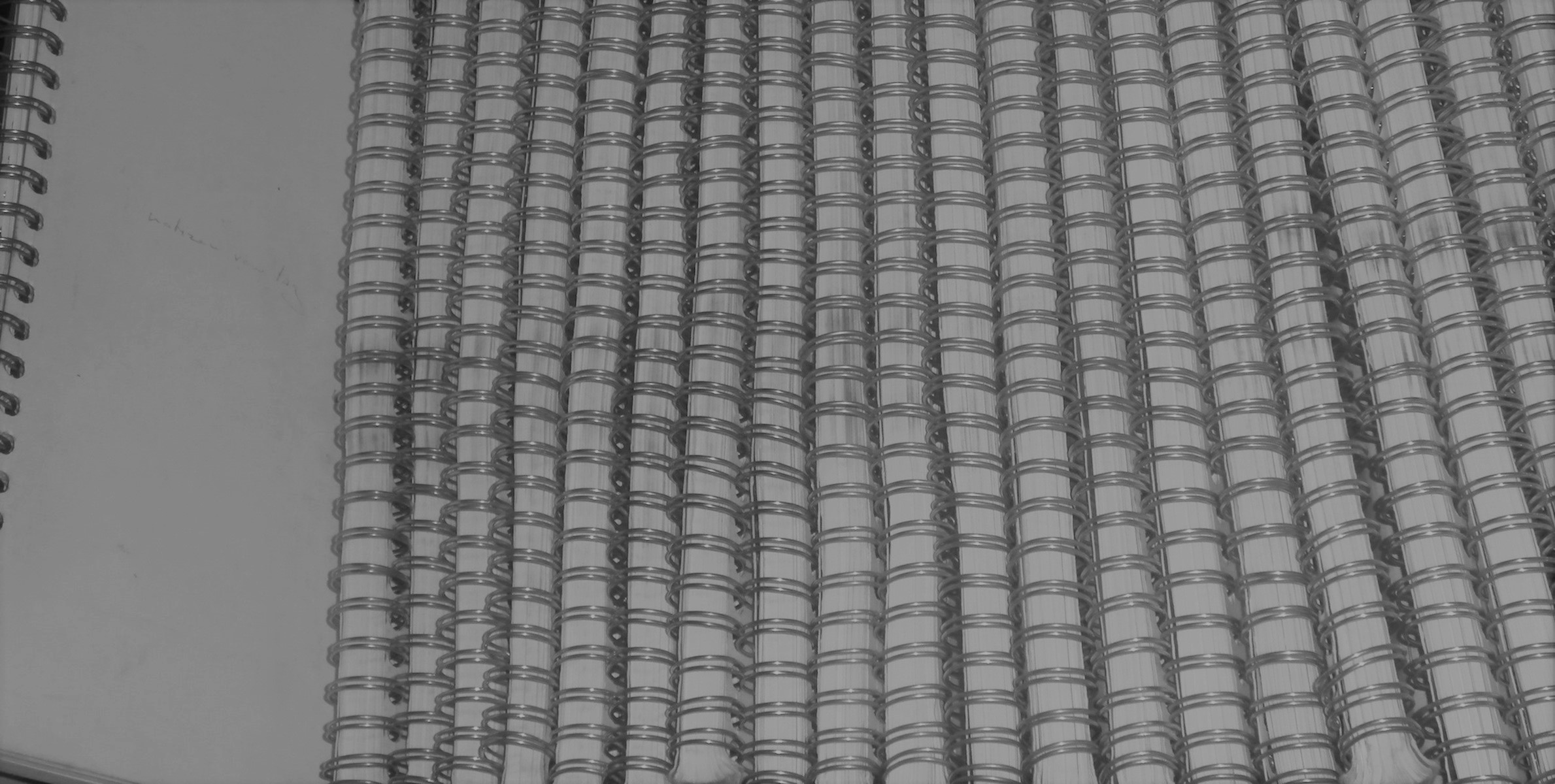Sie hatten ihre Adresse gefunden. Weil sie sich den einen Kontakt noch offen gehalten hatte, über all die Jahre. Weil sie ihn, der schon fast ein Freund geworden war, nicht aufgeben wollte, nur weil er nicht hat widerstehen können und wieder Kontakt aufgenommen hat mit seinen Eltern, die wahrscheinlich immer noch mit drin steckten. Nun hatte sie die Quittung. Sie hätte den Kontakt abbrechen müssen, spätestens ab der Nacht, in der er ihr erzählt hat, er sei wieder zu seinen Eltern gefahren und wie schön das doch gewesen sei und nun sei er doch endlich nicht mehr allein undsoweiter. Aufgenommen in Muttermund und Vaterpenis, heimgekehrt in den tiefsten Schoß. Nun hing sie auch wieder mit drin, bis weit nach Italien hinein. Und sie hatte doch gehofft, sie wäre draußen. Beim nächsten Umzug wird sie auch ihren Namen ändern müssen. Und mit keinem, KEINEM mehr telefonieren. Es gab keine Freunde, nicht in diesem Feld. Sie waren alle unberechenbar und nie verlässlich. Auch sie. Vielleicht hatte sie ihre Adresse selber rausgegeben. Sie traute sich nicht.
Einrad fahren.
Sie hat ihr Einrad aus dem Keller geholt. Sie kann es noch, es geht! Diese Freude im Körper. Und die Erinnerung an den Freund, der zwei Tage lang mit ihr die Straße auf und ab gelaufen war, ihre Hand auf seiner Schulter. Mit dem Einrad ist sie meist in den Wald gefahren. Wer sie nicht kannte, hat sie für einen Jungen gehalten, mit den kurzen Haaren. Mädchen hatten lange Haare zu haben. Mädchen fuhren auch kein Einrad. Und Mädchen hatten keine Hosen zu tragen. Dass sie sich keine Kleider und Röcke mehr anziehen ließ, seit sie sich handgreiflich wehren konnte, war ständiges Streitthema. Mutter fand ihre Fußballerbeine hässlich und die Kellerkleider furchterregend. Sie hatte sich etwas anderes vorgestellt. Wenn schon nicht einen Sohn, dann wenigstens eine anständige taugliche Tochter. Tauglich wofür? Fürs Verheiraten? Aber verheiratet wurden die Töchter schon lange nicht mehr. Wozu dann die Kleider? Für die Väter und Großväter? Sie kann böse werden, heute noch. Sie war nie nett genug, für Kleidchen.
mit nichts drin.
deine Texte und Briefe sind wie schönes Geschenkpapier. mit nichts drin.
sie erinnert sich an den Jungen, der das gesagt hat. zwei Kinder, die ein bisschen Sex ausprobiert haben. und ein paar Briefe hin und her geschrieben.
in manchen von ihren Texten ist noch heute kein Inhalt. nur Sprache. und Rhythmus.
den Inhalt darf keiner sehen. wenn es um Sex geht, noch weniger.
für den Jungen ging es um Sex.
Krieg. Und Geld. Als wäre es dasselbe Wort.
Er hat in der Waffenfabrik gearbeitet. Hochpräzisionsinstrumente entwickelt. Und sehr viel Geld verdient. Mehr als andere in ähnlichen Berufen anzuhäufen pflegten.
Nach dem Krieg ist er nach Deutschland gefahren. Nach Köln. Von Köln stand kaum noch etwas. Er wollte sofort wieder nach Hause. Danach ist er nie mehr verreist.
Den Engländern hat er Material entwickelt, auch lange noch nach dem Krieg. Sie weiß nur, dass er stolz war, ein Leben lang, auf seine Präzision. Hochpräzision, wie er sagte.
Sie wollte immer mal nachforschen, was genau er entwickelt hatte. Und wofür es verwendet wurde. Aber jetzt will sie es lieber nicht mehr wissen.
Sie hat das Geld geerbt. Jetzt muss sie zusehen, wie sie es vom Krieg trennt.
adoptiert
Sie war adoptiert. Sie wusste das. Natürlich. Ihre Eltern gingen immer offen damit um. Sie war mit sechs in die Familie gekommen. Mit sechs Jahren. Sie nannte das ihre Geburt. Ich wurde mit sechs geboren. Die Leuten lachten dann. Ihre Mama korrigierte sie. Freundlich, aber bestimmt. Es blieb dennoch dabei, sie konnte das gar nicht anders sagen. Sie hatte keine Erinnerung an diese ersten sechs Jahre ihres Lebens. Sie wusste nicht, wo sie in die Kita gegangen war und wer ihre Freunde gewesen waren. Sie hatte keine Bilder von solchen Freunden. Sie wusste nicht, wie sie selber ausgesehen hatte, mit zwei, oder drei. Ob ihre Haare vielleicht früher blond waren, die Augen blau, wie bei anderen Kindern, oder immer schon braun. Heute hat sie braune Haare, braune Augen. Und weiß nicht von wem. Sie hat dieses unbestimmte Gefühl, dass sie es auch nicht wissen möchte. Mehr war da nicht. Jedes Mal, wenn ihre Mama mit ihr davon sprach, dass sie ja schon viel erlebt hätte, auch schon viel Schlimmes, dann hört sie plötzlich nicht mehr zu. Sie sieht Mama sprechen, die Lippen bewegen, kein Ton kommt bis zu ihr. Sie spielt oder zieht sich ein Buch in die Nähe, die Mama fragt, hörst du mir zu, sie nickt, irgendwie kann sie solche Fragen immer hören, vielleicht, weil so viel Nachdruck darin liegt, ansonsten verfließt alles. Sie kann sich an kein einziges Gespräch erinnern, sie wüsste nicht, dass ihre Eltern ihr je etwas Konkretes erzählt hätten, von der Zeit davor. Daher bleibt es dabei, auch wenn die Mitschüler lachen. Sie erzählt es mit einem gewissen Stolz. Ich bin mit sechs Jahren geboren worden. Ich bin adoptiert.
du, sag mal.
sie setzte sich vor ihren Mann. du, sag mal. hast du das schon mal gehört. was früher die multiple Persönlichkeit war. und heute die dissoziative Identität. was meinst du, wenn ich so eine wäre?
aha.
mehr kam da nicht. weder das große Begreifen Verstehen, endlich, das erklärt ja alles. noch ein wilder Protest, nein, du doch nicht.
sie wusste nicht, was sie sich mehr gewünscht hätte.
die Pornoseite.
ein Blick auf die Startseite. zum ersten Mal fand sie es nicht erregend. sie klickte sich nicht von Film zu Film. im Gegenteil. sie fand es nur eklig. am liebsten hätte sie gekotzt. das war neu. sie löschte den Link aus ihren Favoriten.
Rotwein. Salami. Und Eis.
Eine wunderbare Kombination. Rotwein. Italienische Salami. Und Walnuss-Eis.
Als Kind hatte sie Salami und Schokokekse gemischt. Eine Scheibe Salami. Ein Schokokeks. Eine Scheibe Salami. Dazu Orangensaft.
Als Studentin hatte sie Salami und Salzstangen mit schwarzer Schokolade gegessen. Dazu Grappa getrunken. Oder Amaretto. Oder Limoncello. Immer direkt aus Italien. Sie hatte da ihre Quellen.
Heute hat sie keine Quellen mehr. In Berlin ist sie abgeschnitten von Italien. Keiner der Männer hat sie je wieder gefunden. Sie hat die Adresse geheim gehalten. Dachte sie.
Und nun stand er plötzlich vor der Tür. Tintoretto. Der Sohn von Sebastiano. Mit einer Flasche Grappa. Und einer dicken Salami.
Sie hat ihm die Tür vor der Nase wieder zugemacht. Ohne großen Knall. Beinahe sanft. Ohne die Geschenke anzunehmen. Schade eigentlich.
Nun hat sie sich einen Wein aufgemacht. Italienische Salami aus dem Supermarkt, direkt in der Packung auf den Tisch. Und auch das Eis serviert sie sich nicht, sie isst es aus der Box. Es schmeckt ihr. Auch wenn es vermischt ist mit Angst. Wie früher.
Die Angst nimmt ab, je mehr sie isst, je mehr sie trinkt. Sie weiß, das ist keine Lösung. Dennoch findet sie es gut. Heute. Über den nächsten Umzug kann sie sich morgen Gedanken machen. Und woher überhaupt Tintoretto an ihre Adresse gekommen war, nach all den Jahren.
Angenehm milde gestimmt geht sie ins Bad, sanft wäscht sie sich das Gesicht und geht schlafen.
sie trinkt.
sie trinkt Bier. obwohl sie gar nicht wollte. sie trinkt Bier. obwohl sie heute morgen Kopfschmerzen hatte. es ist nicht dieselbe, die jetzt Bier trinkt. sie weiß zwar von den Kopfschmerzen, aber es kümmert sie nicht. sie trinkt. die Kopfschmerzfrau wird es aushalten müssen. morgen.
Ich finde mich schön.
Sie schaute sich ihr Bild an. Sie fand sich schön. Und wußte nicht, woher dieses Gefühl kam. Weil sie sich überaus hässlich fand und unsicher und unfähig. Ohne jegliches Selbstvertrauen, außer am Arm ihres Mannes. Und am Arm ihres Mannes sah sie immer ein bisschen so aus wie sein Kind. Sie wusste das, seit Freunde ihnen einen Magneten für den Kühlschrank geschenkt hatten, mit einem Bild von ihnen beiden als Paar. Sie hing an seinem Arm und hielt sich fest und wollte ihn nie mehr loslassen. Und beschwörte ihn, sie doch zu umarmen, so richtig, mit aller Kraft, dass sie es spüren konnte. Vielleicht sogar zu glauben beginnen könnte, dass er sie immer noch liebte, nach all den Jahren. Er konnte oft nicht verstehen, wie sie so unsicher sein konnte, und ihn bei Kleinigkeiten um seine Erlaubnis oder um eine Entscheidung bitten. Ihn anflehen, nicht um einen Rat, sondern dass er doch bitte sagen sollte, was sie zu tun hatte, es wäre so viel einfacher für sie. Aber das verstand er nicht. Weil sie doch auch eine erfolgreiche Geschäftsfrau war. Und singen konnte, wie eine Göttin. Er liebte ihre Stimme. Und dann saß sie heulend am Küchentisch, wenn er ihr gerade mal nicht bestätigen mochte, dass er sie immer noch liebte, auch morgen noch lieben würde, ja klar, wieso denn auch nicht, er verstand das nicht.
Dass sie sich schön fand, so richtig schön, das war selten. Sie nahm das Bild nochmals zur Hand. Es tat gut, sich selber eine Weile schön zu finden. Sie genoss das.
ein Gespräch.
wo willst du denn hin
die Kinder holen
ach so
oder soll ich sie dort lassen
das wär auch mal eine Idee
Zu früh. Zu müde.
Morgens um fünf aufgewacht.
Wasser kochen. Tee aufgießen. Ziehen lassen.
Routinen. Wie schreiben. Die Hand am Papier am Stift. Erstaunlich, was eine Hand alles leistet, im flüssigen Schreiben. Von einer Seite zur andern, die feine Koordinierung der Bleistiftspitze, ähnliche Schrift, jeden Tag. Und unterschiedliche Schriften, je nach Emotion. Und nochmals eine andere beim „Kopfschreiben“. Wenn ich nur aus dem Kopf schreibe, ist die Schrift anders als wenn der Stift fliegt. Und Dinge schreibt, die mich selber überraschen.
Heute gelingt es mir nicht, mich zu überraschen. Es ist zu früh. Ich bin zu müde.
Lebensgeschichtslosigkeit
Jutta schreibt an einem Buch zur Lebensgeschichtslosigkeit.
So viele Figuren in meinen Texten haben keine Erinnerungen. Oder stark fragmentierte Erinnerungen. Oder so scheussliche, dass keiner sie hören will.
Lebensgeschichtslosigkeit. Mir gefällt das Wort. Ich warte auf das Buch.
Bier trinken.
Er war betrunken. Er hatte schon vier Bier getrunken. Und das fünfte, das war auch schon fast leer. Dem andern sein Bier war noch fast voll. Er kannte ihn nicht, den andern an seinem Tisch. Jetzt setzten sich die Leute ja schon wieder zu einem an den Tisch. Das durften sie zwar noch nicht. Aber den meisten war das egal. Solange sie wieder trinken konnten. Mit dem andern saß er jetzt schon fast eine Stunde zusammen. Er wusste nichts von ihm. Sie hatten kein Wort gewechselt. Der andere hatte einen Anruf angenommen, ja Schatz, ich bin gleich da, und wieder aufgelegt. Mehr wusste er nicht von ihm. Jetzt war er auf Klo. Er stellte sich vor, wie der andere in den Toilettenraum trat, sich hinter einen pinkelnden Mann stellte, ihm die Hose hinten ein wenig runterzog und ihn fickte, bevor er nach vorne trat und in aller Ruhe pinkelte. Schaumig pinkelte. Ohne zu spülen. Und ohne die Hände zu waschen. Und bevor der andere wieder zurück kam, vom Klo, griff er mit seiner eigenen Hand nach dessen Bier, das noch fast voll war, und nahm ein paar lange tiefe Züge. Wenn sie schon an einem Tisch saßen, konnten sie auch aus einer Flasche trinken.
Träumen.
Er träumt wieder, jede Nacht. Es ist nicht angenehm.
Eingezwängt.
Die Vögel lärmen. Mir tut die Brust weh, das Atmen. Ich war eingezwängt, nachts, zwischen Kindern und Mann. Wiesehr die Kinder in die Nähe rutschen, in diesen Zeiten. Nichts mit im eigenen Zimmer im eigenen Bett. Mama, ich habe Angst.
Eingepinkelt.
Eingepinkelt. Das Gesicht in die nasse Hose gedrückt. Den Hintern versohlt.
Und stattdessen ist alles ganz anders. Eine große dicke runde Frau mit riesigen Brüsten in wunderbar farbigen Kleidern, Schichten von Stoffen übereinander, nimmt sich eines ihrer vielen Tücher vom Leib, wickelt sich aus und mich ein, steht vor mir, in neuen Farben, und umhüllt mich mit diesem warmen sanften gelb und grünen Tuch, fast ohne mich zu berühren, und doch sitzt der Stoff fest, dass ich mich umarmt fühle, samten, und unter dem Stoff die nasse Hose ausziehen kann, ohne dass mich einer sieht.
Die nasse Hose lasse ich liegen, ich brauche sie nicht mehr.
Eine Treppe höher.
Sie ist eine Treppe höher hinaufgestiegen als sonst. In Gedanken. Sie hat den Schlüssel ins Schloss gesteckt. Er passte. Aus dem Flur kam der Nachbar ihr entgegen, mit einem Strahlen, fast einem Grinsen im Gesicht. Schön, dass du mal bei mir vorbeischaust. Magst du einen Tee trinken – oder lieber direkt ins Bett?
Sie weiß nicht mehr, was sie ihm geantwortet hat. Ob sie überhaupt etwas gesagt hat. Er nahm sie an der Hand und führte sie irgendwo hin – in die Küche, ins Schlafzimmer? – sie erinnert sich nicht. Sie weiß nur, dass sie drei Tage später in gewisser Weise zu sich kam, den Geruch nach Sperma und Schweiß und ungewaschen an ihrem Körper eklig fand, ihren Schlüssel vom Schlüsselbrett nahm und nackig die eine Treppe nach unten ging, mitten am Tag, weil sie ihre Kleider nirgends finden konnte.
Sie war drei Tage nicht auf Arbeit gewesen und hatte anscheinend wilden Sex genossen. Sie schloss ihre Tür mit Schlüssel, doppelt, und schob den Riegel vor. Sie wollte erst mal duschen.
Ich will mich nicht anpassen.
Ich kann nicht schreiben. Ich bin zu wütend, um zu schreiben. Zu traurig. Zu verletzt. Und mit dieser Brille über den Augen, dass es ein guter Text werden muss. Rund. Und auch mit etwas freundlichem drin.
Woher kommt das denn jetzt wieder. Wieso muss jeder Text denn auch etwas freundliches drin haben. Ich will das gar nicht, freundlich schreiben. Manchmal möchte ich, dass es mir wieder egal wäre, wer das ganze Zeug liest. Um wieder brutal zu schreiben. Und wütend. Oder traurig. Oder glücklich verliebt. Wie es gerade ist. Kein veränderter angepasster Schmus.
Ich will mich nicht anpassen.
Am liebsten würde ich immer noch ab und zu auf die Baustelle gehen. Ein Holz in die Hand nehmen. Und zuschlagen. So richtig mit aller Kraft zuschlagen. Das hat gut getan. Dieses Krachen. Holz auf Holz.
Diese wunderbare pure Wut.
Wieder der Müllwagen vor dem Haus. Manchmal habe ich das Gefühl, die kommen jeden Tag. Die Häuser zittern, der Lärm ist unangenehm. Ich möchte Stille. Und meine Wut kultivieren.
Wenn sie in Reinform wäre, ohne die ganze alte Verzweiflung und Trauer, wie würde sie wohl aussehen. Rot. Oder Gelb. Ich weiß es nicht mal. Schwarz. Vielleicht schwarz. Ein riesiges schwarzes Loch, in dem ich alle zusammenschlagen könnte. Eine Grube, wie früher, als Kinder. In großen Bandenkriegen haben wir uns stundenlang verprügelt, auf den Baustellen der neuen Häuser am Dorfrand, nach vier, wenn die Bauarbeiter gegangen waren. Mit langen Dachlatten aufeinander losgeprügelt, Lanzen und Spieße von richtigen Rittern. Wir Mädels mittenmang, mit genauso viel Kraft, genauso viel Wut, oder mehr noch. Von dieser puren Wut, die nur noch schwarz sieht, das Holz in der Hand, und rennen, und schlagen. Bis die eine oder andere der Banden als Sieger galt, für den jeweiligen Tag. Und wir auch noch ein paar freundliche Worte mit den Feinden wechseln konnten, auf dem Heimweg. Oder den ein und andern verarzten gehen, bei der ein oder andern Bauernhof-Oma. Die Großmütter auf den Höfen haben am wenigsten gefragt. Und nicht gleich diese Predigten gehalten. Verletzen konnte man sich überall, im Wald im Feld im Stall in der Scheune. Das gehörte dazu. Nicht so bei uns Häuschenleuten. Da war es unangenehm, verletzt nach Hause zu kommen. Und keine Erklärung bereit zu haben. Den Rausch des Kampfes konnte man nicht erzählen. Diese wunderbare pure Wut.
Schwerverletzte gab es nur ein einziges Mal, nachdem die andern unsere mühsam in tagelanger Arbeit in einen Erdhügel gegrabene, für die Bauarbeiter perfekt getarnte Höhle über Nacht zerstört hatten. Nicht im fairen Kampf, sondern heimtückisch hinterrücks nachts. Dafür gab es keine Entschuldigung. Das Holz wurde zu Metall, auf den Baustellen lag genug gefährliches Material. Waffen in den Händen von Kindern, die keine Regeln mehr kannten, nur noch Rache.
Ab da war es vorbei mit unseren wunderbaren Kämpfen und Kriegen auf den Baustellen, keiner ließ uns mehr unbehelligt spielen. Uns fehlte etwas. Die Wut verlegte sich in den Untergrund, auf den Pausenhof, unter Aufsicht. In diese fiesen Querelen, die so viel mehr verletzt haben als all die Hölzer auf den Baustellen.
Ich wünschte mir Baugruben. Für die Kinder. Und Wälder. Und Felder.
Und kam nicht wieder nach Hause.
Sie ging Brötchen holen, Sonntag früh, zum ersten Mal allein. Gerade sechs geworden, ein schönes Mädchen. Und kam nicht wieder nach Hause.
Sie versucht, sich zu erinnern, wie das damals war, zu verschwinden. Wie leicht, in gewisser Weise. Der fremde Hausflur, die offene Tür. Und sich mitten in die Familie gesetzt. Die Familie war nett, die Familie war riesig. Auf ein Kind mehr oder weniger kam es nun auch nicht an. Wenn das Jugendamt kam, hielt sie sich versteckt. Das Jugendamt kam oft, solche Großfamilien sind suspekt, mehr als ihre eigene das je war. Aber sie haben sie nie gefunden, all die Jahre nicht. Die Familie hat ihr die Haare gefärbt, tiefschwarz, und sie gestreckt, geglättet. Keiner hätte sie erkannt. Sie glich ihren drei Schwestern aufs Haar. Alle diese schwarzen langen Haare, helle Haut und blaue Augen. Blau und schwarz. Keiner im Haus hat ihr je eine Frage gestellt. Sie wurde gemeldet, als ein bisher bei den Großeltern im andern Land noch gelebtes Kind. Mit einer Geburtsurkunde, woher auch immer die Familie sie hergekriegt hatte. Sie konnte bleiben, als Schwester von drei Schwestern. Als Kind der Familie ging sie zur Schule, keiner hat sie dort je gesucht. Sie galt lange als vermisst. Irgendwann haben ihre Eltern sie totschreiben lassen.
Sie lehnt sich zurück. Sie erinnert sich gern an ihr Verschwinden. Sie telefoniert noch heute fast täglich mit der ein oder andern von ihren Schwestern. Zwei von ihnen sind ins andere Land gezogen, „nach Hause“, obwohl sie vorher nie dort gewesen waren. Eine lebt in Deutschland, wie sie, ganz in der Nähe. Sie sehen sich oft. Dass sie nicht Schwestern sein könnten, kommt ihnen kaum je noch in den Sinn. Wenn sie sich daran erinnern, lachen sie. Lange und tief und warm.
Ich hätte gerne eine andere Haut.
Ich habe die Haut meiner Mutter geerbt. Ich hätte gerne eine andere Haut. Eine, die im Sommer braun wird, statt fleckenübersät gesprenkelt. Alt sieht sie aus, meine Haut, wenn sie zu viel Sonne abkriegt. Wie die Haut einer alten Frau.
Ich hätte gerne eine andere Haut. Aber ich weiß, woher sie kommt. Meine Tochter weiß nicht, von wem sie ihre Haut hat. Oder ihre tollen Locken. Ich stelle mir vor, sie kommen von ihrer leiblichen Mutter. Aber woher will ich das wissen. Vielleicht sind sie auch von der Oma, die Locken, und die Haut kommt vom Vater.
Ich weiß, woher meine Haut kommt. Großmutter hatte auch schon eine solche. Sosehr ich mir im Sommer jeweils eine andere Haut wünschte, so gibt es doch ein Stück Boden in mir, zu wissen, woher alles kommt. Als könnte ich je von allem wissen, woher es kommt. Aber so fühlt es sich an. Als hätte ich zumindest die Möglichkeit, von so vielem zu wissen oder herauszufinden, woher ich es habe, von welchen Vorfahren und Ur-Vorfahren.
Ich sitze auf dem Balkon, die Sonne ist verschwunden. Für meine Haut ist das gut. Ich möchte nicht alt aussehen, nicht jetzt schon.
Erfinden.
Sie hat keine Erinnerung. Sie versucht, sich eine Kindheit zu erfinden. Wo soll sie anfangen. Womit. Wie hat sie ausgesehen, als dreijährige, fünfjährige, siebenjährige. Wo ist sie zur Schule gegangen und mit wem. Was hat sie gerne getragen, was hat sie gerne gegessen. Und war sie lieber allein im Wald oder mit den Freundinnen in der Eisdiele.
Sie versucht, sich etwas auszudenken, das zu ihr passen könnte.
Sie erfindet sich eine Kindheit. Wie einer Figur. In einem Buch.
Sie notiert es sich. Weil sie es sonst gleich wieder vergisst.
Dem nächsten, der fragt, wird sie etwas erzählen können.
Löschen.
Sein Bruder hatte ihn angerufen, ihm auf Band gesprochen. Er war gar nicht erst rangegangen, er wusste, dass ihm das nicht gut tat. Aber der Anrufbeantworter stand in der Küche, das Blinken am Apparat blieb. Wie sollte er das Blinken ausschalten, ohne die Nachricht zu hören? Konnte man die Nachrichten direkt löschen?
Das hat er dann gemacht, das war tatsächlich möglich. Die Nachricht startete nicht, er musste die verhasste Stimme nicht hören. Verhasst, weil sie immer so freundlich klang, sich so durch und durch freundlich anfühlte, als wäre nicht nur nie etwas vorgefallen, sondern als wäre im Gehirn seines Bruders auch tatsächlich nicht die kleinste Spur eines Vorfalls übrig geblieben. Keine Erinnerung, keine Ahnung, keine Vermutung, nicht mal die leiseste Möglichkeit eines Vorfalls. Geschweige denn wiederholter Vorfälle.
Eine grundfreundliche Stimme, liebevoll im Ton, als würde es ihn tatsächlich interessieren, wie es ihm ging. Ihm, dem schwarzen Schaf in der Familie, dem psychisch kaputten, dem wirtschaftlich zumindest instabilen. Es machte ihn gleich nochmals wütend, dass ihm ein großes Vorerbe ermöglicht würde, sobald er endlich bereit wäre, sein Leben den Vorstellungen der Familie anzupassen. Sein Bruder hatte die Methode der Alten verteidigt, sieh doch, das macht doch Sinn, bei deinem Lebenswandel, sonst ist das Geld doch gleich weg. Seither hasste er die freundlichen Nachfragen auf dem Anrufbeantworter noch mehr.
Er ging schon länger nicht mehr ran, wenn sein Bruder ihn anrief. Diesmal hatte er die Nachricht zum ersten Mal nicht mehr abgehört. Er spürte die Erleichterung, körperlich. Dass nicht erst die Stimme angehen musste, bevor er das Symbol mit dem Mülleimer auswählen konnte. Aus seiner Sicht war diese alles-ist-gut-und-alles-war-immer-gut-gewesen-Stimme schlicht Müll. Seine Wahrheit sah anders aus, auch wenn er wusste, dass es Wahrheit im Gehirn nicht gab. Dass sein Leben seither, die Jahrzehnte, seit er ausgezogen, dass all die Jahre rückwirkend die Erinnerung verändert verfärbt geschärft verfälscht und neu gemalt hatten. Bis nichts mehr stimmte, nichts mehr war wie es war. Dennoch vertraute er seinem eigenen Erinnerungsgefühl um vieles mehr als dieser schein-freundlichen glückliche-Kindheit-Bruderherz-Stimme.
Jetzt konnte er löschen. Und er war sich im genau selben Moment bewusst, dass er dann auch die Todesnachricht verpassen würde, wenn es so weit war. Dass er dann auch nicht hören würde, wie sein Bruder mit freundlich-tieftrauriger Stimme ihm mitteilen würde, dass Vater oder Mutter jetzt tot waren. Wenn es wichtig war, würde irgendjemand ihm schreiben, das reichte ihm. Und wenn er enterbt sein sollte, bis dahin, dann sollte ihm das auch recht sein. Sie sollten sich auch posthum nicht mehr einmischen in sein Leben. Er war psychisch und wirtschaftlich nicht stabil. Aber lieber instabil, als alles hinter einer freundlich-liebevollen Wand des Vergessens.
Er war sich sicher, dass er, wenigstens er, im Tod im Sterben dann nicht mehr ganz so viele unbekannte seltsame verschreckende Szenen würde sehen müssen. Weil er viele Dinge schon kannte, die der letzte Film ihm würde vorspielen können. Er freute sich eher darauf, es sich dann nochmal im Zusammenhang und in der Chronologie anzusehen. Hoffentlich wird sein Tod ihm Zeit lassen für das Abspulen des gesamten Films.
Auf der Suche nach einem goldenen Faden.
Ich wollte nicht über Kopfschmerzen schreiben. Ich habe doch über Kopfschmerzen geschrieben. Weil ich wieder so oft Kopfschmerzen habe, in dieser Zeit.
Ich tauche mit meinen Kopfschmerzen in Bilder ein, wie Kinder von Erwachsenen gequält werden. Wie ihnen die Erinnerungen gestohlen werden, damit sie nicht aussagen können. Damit sie nicht einmal um Hilfe rufen können. Womit denn, mit welcher Begründung? Es war ihnen ja nichts geschehen. Ihr inneres Gefühl allein? Dem glaubt doch keiner. Erst recht nicht, wenn die Erwachsenen so freundlich sind, gut eingebunden in der Gemeinde.
Ich wünsche niemandem Kopfschmerzen. Und doch, manchmal doch. Ich möchte schreiben können, bis die Kopfschmerzen fühlbar werden, die Finger in den Schläfen. Nicht nur für traumatisierte Menschen, die sich erinnert fühlen. Sondern auch für Menschen, denen es gut gegangen ist, die mehr Widerstand in sich haben, gegenüber solchen Schilderungen, die sich innerlich wehren, sich einzufühlen.
Obwohl es oft so schrecklich ist, sich einzufühlen. Ich möchte schreiben können, bis alle lesen möchten. Weil der Text als Text so schön ist. Nicht der Inhalt, aber der Text. Bis der Text nicht nur einen Sog bereit hält, sondern auch eine Einladung. Einen goldenen Faden. An dem die Leserinnen und Leser nach den Schrecklichkeiten wieder auftauchen können.
Kopfschmerzen.
Kopfschmerzen. Der Kopf eingezwängt in Schraubzwingen. Die Finger in den Schläfen. Finger, die hinein drücken, ins Weiche, ins Gehirn. Als könnte die Mutter ihr ins Gehirn fassen. Und die Bilder verändern, die Erinnerungen. Der Kopf wird hinunter gedrückt, bis auf die Tischplatte. Der Druck im Kopf ist so hoch, dass ihr schwarz wird. Schmerz gibt es keinen mehr. Wenn sie wieder aufwacht, weiß sie in der Regel nicht mehr, was geschehen ist. Als wäre ein ganzer Nachmittag ausgelöscht. Fünf sechs Stunden, die ihr fehlen. Immer wieder. Zusammengezählt wären das ganz schön viele Tage und Wochen und Monate. Lebenszeit, von der sie nichts mehr wusste.
Seit sie wieder öfter Kopfschmerzen hat, sieht sie die Finger ihrer Mutter in den Schläfen ihrer Schwester. Und spürt die Finger am eigenen Kopf. Aber was sind diese Bilder? Erfindungen ihres schmerzgeplagten Kopfes? Erinnerungsbilder, die jetzt nach vierzig Jahren langsam durch die Barrieren sickern? Wahrheit? Oder Verleumdung?
Sie weiß von einigen Quälereien, die ihr von Menschen aus der Kindheitsnachbarschaft bestätigt wurden. Aber die Schraubzwingen? Die Finger in den Schläfen? Wären nicht Spuren sichtbar gewesen, am nächsten Tag, in der Schule?
Es gibt so viele Wege, spurenlos zu quälen.
Ich habe mich dazwischen gestellt.
Ich habe mich zwischen die Jugendlichen gestellt. Ohne zu zögern.
Ich habe mich dazwischen gestellt, obwohl sie alle einen Kopf größer waren als ich, einige um vieles schwerer. Zwei Mädchen, am Rand, der Rest schwarz gekleidete Jungs, die ganz plötzlich einen der Kleinsten aus ihrer Gruppe umringt haben, an den Metallzaun gedrückt, am Sportplatz, direkt am Spielplatz. Ihm ins Gesicht gefasst, den Kiefer gepackt, den Arm verdreht. Es sah alles andere als freundlich aus.
Ach was, das ist doch nur Spaß, das ist mein Cousin, das ist mein kleiner Bruder, wir haben ihn ganz doll lieb, Küsschen auf die Wange, siehste. Aber für mich, für mich sah das alles nicht nach liebhaben aus.
Sie sind wieder verschwunden, vom Spielplatz. Männer fragen mich, hinterher, was denn gewesen sei. Väter mit kleinen Kindern. Keiner ist dazwischen gegangen. Habe ich übertrieben?
Ich spüre, wenn einer Angst hat. Der Kleine hatte Angst. Ich kann Angst nicht ignorieren. Meistens lähmt sie mich, auch fremde, von außen miterlebte. Heute nicht. Heute bin ich aufgestanden, ohne zu denken, ohne zu zögern. Und habe mich dazwischen gestellt. Klein und schmal zwischen Großen. Ich habe mich keinen einzigen Moment gefährdet gefühlt. Als wären sie froh, dass eine etwas sagt. Als wären sie mir dankbar, auf eine seltsam verquere Weise.
Mein Blut wirft Blasen, jetzt noch, lange hinterher. Im Affekt habe ich mich nicht gespürt. Ich stand mitten drin, und es war in Ordnung. Als hätte es Raum gegeben, rund um mich. Als hätte man mir, MIR, ganz subtil ein ganz klein wenig Platz gemacht. Ein ganz klein wenig Achtung, unter all den rauen Reden. Es ging mir nicht schlecht, unter den Jungs. In einem schmalen Bereich habe ich mich sogar wohl gefühlt. Mich gebadet, in dieser Halbstarkenpower. Als könnte ich sie aufsaugen.
Ich habe mich dazwischen gestellt. Ohne Angst.
Das war gut.
Mit den Jahren sind die Träume weniger geworden.
Sie hatte ihn selber losgeschickt. Er war viel zu müde, um noch etwas für sich selber einzufordern. Die Kinder waren so klein, die Nächte so furchtbar, die Tage so herausfordernd. Da hatte sie ihn losgeschickt, Motorrad fahren. Eine Pause von den Kindern, eine Pause von der Frau, eine Pause von allem. Fahrtwind, leere Straßen, die Weite Brandenburgs. Irgendwo in einer Bäckerei einen Kaffee trinken, ein Teilchen essen. Und wieder fahren, durch die Wälder brausen, über die vereinzelten Hügel, deren gebogene Straßen sich anfühlen wie Passstraßen, in dem platten Land.
Sie hatte ihn selber losgeschickt. Oder war es ein anderer Tag? Er war manchmal auch von sich aus losgefahren. Wenn sie ehrlich war, konnte sie sich einfach nicht mehr erinnern. Es gab so viele Tage, an denen sie mit den Kindern auf dem Balkon gestanden hatte, über die Jahre. Ein kleines auf dem Arm, ein zweites, ein drittes, später standen sie schon selber am Geländer. Sie hatten ihm hinterhergeschaut und gewunken. Welch ein schöner Mann. Welch ein wunderbarer Papa.
Sie konnte sich nicht erinnern, wie es gewesen war, an jenem Tag. Als würde alles davon abhängen, ging sie wieder und wieder die Abschiedszenen durch, die in ihrer Erinnerung gesammelt lagen, die gemeinsamen Frühstückszeiten an freien Tagen, was hatte sie gesagt, was er, was die Kinder. Vielleicht hatte auch die Große ihn losgeschickt? Weil sie bereits wusste, wieviel ruhiger, entspannter, zufriedener er nach Hause kam, nach einer Motorradtour, nach seinen Fahrten durch Brandenburg.
Das Gefühl blieb bestehen, über viele Jahre, dass sie ihn selber losgeschickt hatte. Dass sie NUR etwas anderes hätte sagen müssen, am Frühstückstisch. Sie träumte davon, wie sie ihn zurückhielt, nein, heute nicht, bitte, ich bin zu müde, ich kann nicht, alleine mit den Kindern. Oder wie ein Kumpel anrief, etwas von ihm wollte. Oder wie sie sein Losfahren hinauszögerten, sie und die Kinder, mit so vielen Dingen, die sie ganz dringend noch von ihm brauchten, bevor er endlich losfahren konnte. Sie träumte, wie er eine Stunde später an der Unfallstelle vorbeifuhr, wo die Helfer bereits die Trümmer beiseite geräumt hatten. Träumte, wie er an den See fuhr, einen Kaffee trank, und wieder zu ihnen zurückkam.
Mit den Jahren sind die Träume weniger geworden. Die Kinder haben nicht mehr so oft geweint. Sie hat die Farben wieder gesehen, den Duft der Linden wieder wahrgenommen, als könnte sie ihn auf der Haut spüren.
In dem Frühsommer, als sie zum ersten Mal die Linden wieder blühen gerochen hat, in dem Frühsommer hat sie sich neu verliebt. Sie hätte das nicht für möglich gehalten.
Ein Appell.
„Ich will, dass wir hinschauen. Bis wir sie sehen können. Die Kinder, die unsere Hilfe brauchen.“
Schreiben in der Hoffnung, Augen zu öffnen. Schreiben fürs Hinschauen, fürs Helfen, die Hand ausstrecken. Ein freundliches Wort, einmal sitzen bleiben neben einem seltsamen Kind auf dem Spielplatz, auch wenn es anstrengend ist. Weil es distanzlos ist, oder in meine Tasche greift. Weil es viel zu nahe Fragen stellt oder manipuliert, die anderen Kinder, und mich. Weil es aggressiv ist, andern weh tut, im Verborgenen, in den Holzhäusern, hinter den Büschen, wehe du erzählst es einem. Weil die Augen so sind, dass wir lieber wegschauen und uns woanders hinsetzen. Oder weil es viel zu still in einer Ecke sitzt, immer ohne Eltern auf den Spielplatz kommt. Oder schnell wechselt, zwischen super still und super laut, zwischen auffällig im Mittelpunkt und quasi nicht mehr sichtbar, obwohl es noch auf dem Platz ist. Und und und.
Kinder mit schwierigen Augen. Die schön sein können. In die wir trotzdem nicht so gerne schauen.
Es merken, wenn wir wegschauen. Und dann nochmals hinschauen! Und nochmals. Und immer mal wieder. Die meisten lassen sich nicht im Verborgenen betrachten, sie merken unsere Blicke sofort. Nicht wegrennen, innerlich, wenn uns eines entdeckt, und zurückschaut, und abtastet, mit Alarmsystemen, überlangen Antennen, wer wir sind, was wir sind, was wir von ihnen wollen. Nichts wollen, bitte. Einfach nur da sein. Hinschauen. Da bleiben. Und weiter hinschauen. Freundlich. Offen. Mit dieser Einladung. Wenn du magst, irgendwann, ich bin da. Vielleicht magst du dich ja, irgendwann, irgendwann, mit zu mir auf die Bank setzen. Ans andere Ende. Oder dich in meine Nähe stellen, irgendwo seitlich hinten. Ich werde da sein. Ich habe Zeit.
Und nicht mehr wieder wegschauen, bitte!
Hinschauen.
So viele Bilder. Wenn ich schreibe und in Bildern weile, tauchen so viele verschiedene Bilder auf, die lange nicht alle zu mir gehören. Auch wenn sie sich tarnen wie neu auftauchende Erinnerungen, es fühlt sich eher an wie ein großer Strom von vielen kollektiven Erfahrungen. Wieviele Kinder haben Strafen in kalten Kellern abgesessen. Wieviele tun es heute noch. Und wir schauen weg.
Ich will, dass wir hinschauen. Ich, obwohl es mir wehtut. Die anderen, die ähnliches erlebt haben. Und alle übrigen, die nicht wissen, wie es ist, im kalten Keller allein zu sein. Bis wir es sehen können, in den Blicken der Kinder in der Nachbarschaft. Welche Kinder unsere Hilfe brauchen, weil sie zu oft in dunkeln Kellern hocken.
Allein.
Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein. Ich erinnere mich.
Sie sitzt auf dem kalten Kellerboden, im dünnen Sommerkleidchen. Die Tür ist verschlossen. Es handelt sich um eine Strafe, das weiß sie. Sie weiß nur nicht, wofür. Das weiß sie selten, wenn sie bestraft wird. Und sie wird häufig bestraft.
Sie ist allein. Allein allein allein. Angebunden in ihrem Schlafsack. Am Bettgestell angebunden. Sie kann sich nicht drehen. Und nicht aus dem Bett steigen. Draußen hört sie die Stimmen der Nachbarskinder. Es ist noch hell. Sie spielen auf der Straße. Die Fensterläden vor ihrem Fenster sind geschloßen. In ihrem Zimmer ist es dunkel. Halbdunkel. Durch die Spalten in den Fensterläden kommt Licht.
Sie klopft an die Wand. In der Wand wohnen ihre fünf Schwestern. Die Schwestern sind immer zuhause. Sie leisten ihr Gesellschaft, wenn sie allein ist. Nur im Keller, da kommen sie nicht hin. Der Keller ist ihnen zu dunkel.
Sie klopft an die Wand, und eine nach der andern steigen sie zu ihr ins Zimmer. Carla Carla Franziska Martina Ursina. Wieso die ältesten zwei beide Carla heißen, dazu gibt es eine abenteuerliche Geschichte. Die Älteste war als Baby eine Weile verschollen gewesen.
Sie liegt angebunden in ihrem Schlafsack. Sie ist nicht mehr allein. Sie hört die Stimmen von draußen, die Kinder auf der Straße. Und sie hört die Stimmen ihrer Schwestern, die sie langsam in den Schlaf murmeln. Ihre Schwestern, die sie streicheln, sie lieb haben. Die sie beim nächsten Mal, bestimmt beim nächsten Mal, mitnehmen werden, durch die Wand hindurch, in ihr anderes Land.
Sie weiß nicht, welcher Tag heute ist.
Sie weiß nicht, welcher Tag heute ist. Sie findet das Buch nicht mehr, in dem sie gestern gelesen hat. Oder war das vorgestern gewesen? Aber was war denn dann gestern gewesen?
Nachmittags, mit den Kindern, da war sie auf den Spielplatz gegangen. Eine Freundin hat sie dort besucht, weil Spielplatz der einzige Ort ist, an dem man mit Kindern auch mal ein Erwachsenengespräch führen kann. Durchbrochen von Notfällen, Hunger Pipi Durst Pflaster. Aber dennoch, fast ein Gespräch. Daran kann sie sich erinnern, an den Nachmittag mit der Freundin.
Aber der Vormittag, die paar Stunden ohne Kinder? Sie wollte sollte die Steuer machen, vom Vorjahr. Um nicht wieder so spät zu sein, ausnahmsweise. Die Steuer hat sie jedenfalls nicht gemacht, das hat sie schon gesehen. Der Stapel liegt unberührt, den hat sie nicht angefasst. Was hat sie dann getan? Immerhin vier Stunden. Und wenn jetzt auch noch das Buch weg ist, in dem sie doch gelesen hat, zuhause, auf dem Sessel.
War das vorgestern gewesen? Sie sieht sich sitzen, in dem großen weichen Sessel, mit dem Buch in der Hand. Endlich mal wieder ein Buch, hatte sie noch gedacht. Aber das Buch ist nirgends. Nicht in der Wohnung, nicht in den Taschen. War sie gestern draußen gewesen? Hatte sie es mit nach draußen genommen? Aber wohin?
Ihr Lieblingscafé hat noch geschlossen. Sie weiß nicht, ob es je wieder öffnen wird, nach dieser seltsamen Zeit. Die Leute dort sind schon vorher nicht reich geworden. Viele der Gäste waren Menschen wie sie, die einen einzigen Kaffee tranken und lange lange sitzen blieben. Mit einem Buch oder einem Freund, mit dem Laptop oder mit Stift und Papier.
Sie hat immer von Hand geschrieben, im Café. Sie vermisst diesen Platz, einen ihrer Lieblingsplätze. Sie hat sich dort sicher gefühlt, auch unter Menschen. Nun sitzt sie immer zuhause. Denkt sie jedenfalls. Aber wenn das Buch weg ist?
Sie hat Angst. Große Angst. Mit Worten nicht beschreibbare Angst. Was ist, wenn sie wieder Dinge tut, ohne es zu merken? Wenn sie das Haus verlässt und wieder nach Hause kommt und denkt, sie hat im Sessel gesessen den ganzen Vormittag mit einem Buch?
Und wo, wo genau war sie denn unterwegs gewesen? Jetzt, wo man eigentlich nirgendwo hin gehen konnte. Und mit wem? Wenn das wieder eine Frage wurde, ohne dass sie es gemerkt hatte. Hektisch beginnt sie, nach Spuren zu suchen, in der Wohnung, im Hof, im Fahrradkeller.
Schließlich fragt sie ihre Freundin, ältere Dame, Künstlerin im Erdgeschoß. Deren Fenster gehen zum Hof. Und außer mit dem Hund zu gehen, hat sie nichts zu tun, in dieser Zeit. Keine Aufträge, keine Kurse, keine Filme, kein Geld. Sie sitzt und schaut in den Hof.
Der Blick ihrer Freundin ist klar und wach und freundlich. Ja, du bist gestern Vormittag dreimal mit dem Rad weggefahren und kurz danach wiedergekommen. Vorgestern auch schon, und den Tag davor. Ich habe mich schon gewundert.
Sie wundert sich über nichts mehr. Aber sie fürchtet sich. Und hat keine Ahnung, wohin sie weggefahren ist. Wen sie getroffen hat. Und wozu. Nur dass sie jemanden getroffen hat, oder mehrere, von DENEN, darüber ist sie sich ziemlich sicher.
Ach, komm doch zu mir ins Atelier. Na komm schon. Wir trinken einen Tee und du erzählst. Wir werden schon eine Lösung finden. Und dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo du bist. Das ist doch schon ganz schön viel, oder?
Sie glaubt an keine Lösung. Aber Tee trinken. Und nicht allein sein. Das ist ganz schön viel. Sie lächelt ihre Freundin an. Und tritt ins Atelier. Atmet den Geruch nach Farben und Holz und Leim. Vor dem Fenster blühen die Rosen.
Neue Knospen.
Ein Bilderbuch auf den Knien, Papier darüber. Sonne im Gesicht. Schreiben auf dem Balkon. Der Wind treibt die beiden Windrädchen an. Das eine dreht leise samten. Das andere ist schon alt, vom letzten Jahr, und quietscht und rattert, übertönt die Vögel.
Die Vögel haben lange alle Knospen der Nelken abgebissen. Als Futter? Für die Jungen? Zum Nestbau? Jedenfalls haben sie jetzt aufgegeben. Die Nelke hat neue Knospen getrieben. Heute ist die erste aufgeblüht. In der Früh wahrscheinlich, sie ist schon ganz offen und leuchtet in der Sonne.
Neue Knospen treiben. Überall dort, wo uns welche abgebissen werden. Oder direkt daneben. Wenn ich Musikerin werden wollte, als Jugendliche, als junge Studentin. Und mir alles abgebissen wurde, jede einzelne Knospe. Dann kann ich schreiben. Oder ganz neue Instrumente lernen. Als Erwachsene ein Cello übernehmen, ein gebrauchtes, mit einem wunderbar warmen Ton. Oder plötzlich singen, mehr als Kinderlieder. Mich auf die Straße stellen, wie die junge Frau in der Unterführung, die mich zu Tränen berührt hat, mit ihrem Gesang, mit ihren Texten. Die mir Mut gemacht hat, mich doch mit hinzustellen. Dann haben wir zu zweit gesungen.
Die Leute sind stehen geblieben. Ich habe es nicht gemerkt. Wasser im Gesicht. Klang im Körper. Die Stimme dieser Frau, so jung, so tief, so viel erlebt, so erfahren. Als wäre sie eine weise Alte, die mich an die Hand nimmt, zu meinen ganz eigenen Tönen. Die Menschen wischen sich Tränen aus den Augen, legen Geld in den Hut. Für die junge Frau, für mich, für sich, für die Tränen.
Neue Knospen, wie die Nelken. Lass dir ruhig alles abbeißen, wenn die Vögel hungrig sind. Es wird etwas nachwachsen, irgendwann. Ein wenig reicher, ein wenig kräftiger in der Farbe. Ein bisschen tiefer im Klang.
Es ist schön, auf dem Balkon zu schreiben. In der Sonne. Zwischen Windrädern und Vögeln und Nelken.
Sie wird ihre Eltern nicht mehr kontaktieren.
Frühmorgens. Die Linde mit immer mehr gelb im grün. Bald blüht sie. Ich mag die Linden in Berlin. Ich mag Berlin.
Sie lehnt sich zurück und atmet. Wenn sie nur Nase sein könnte, für die Linden. Und den Rest vergessen. Bis sie nicht mehr weiß, wer sie ist.
Sie wird ihre Eltern nicht mehr kontaktieren. Auch wenn sie langsam alt werden. Es geht ihr gut, in der großen Stadt. Sie braucht niemanden mehr. Sie genießt es, allein zu sein. Sie hat es gelernt geübt. Sie kann nicht mehr anders.
Manchmal sind da Menschen, die sie einladen und dabei haben möchten. Und es gelingt ihr nicht, hinzugehen. Oder ein zweites, ein drittes Mal hinzugehen. Oder sogar selber einzuladen. Auf solche Ideen kommt sie nicht. Sie mag ihre kleine Klause, mitten in der Stadt. Sie hat sich gemütlich eingerichtet, sie mag es niemandem zeigen. Wirklich nicht.
Manchmal gibt es sogar Männer, die an ihr dranbleiben, hartnäckig, wie kleine Anhängsel. Sie lässt keinen mehr ein, weder in sich, noch in ihre Wohnung. Sie hat genug davon. Sie hatte schon immer genug davon. Sie will nicht mehr. Nie mehr. Was auch immer der Mann zu bieten zu versprechen hat. Sogar wenn er Kinder mitbringt, sie lässt ihn abblitzen.
Obwohl, das mit den Kindern. Wenn sie Kinder haben könnte, ohne selber schwanger sein zu müssen. Kinder, die vielleicht schon etwas älter sind, keine Windeln, keine schlaflosen Nächte. Und Kinder, die im besten Fall nur am Wochenende kommen oder jede zweite Woche woanders sind. Wenn sie auf diese oder ähnliche Weise Kinder haben könnte, würde sie einen Mann in Kauf nehmen.
Vielleicht sollte sie es ausprobieren.
Ein schmales Bändchen.
Ich habe die Kurzgeschichten von Frau Reichelt gelesen, Es wäre schön (Logbuch Verlag). Und plötzlich habe ich Lust, mich an meine vielen Kurztexte zu setzen. Weil ich keine Kraft habe, für die großen Projekte, zurzeit. Aber immer mal wieder einen Kurztext bearbeiten, an die Lektorin weiterreichen, mit der Zeit eine Idee erhalten, in welcher Reihenfolge sie stehen könnten? Wieso nicht. Ein schmales Bändchen, oder auch ein dickeres. Ich will mit meinen Romanen raus, das bleibt. Aber vielleicht ist gerade nicht die Zeit dafür.
Schreibanregungen.
Ich war auf dem Blog von Jutta Reichelt unterwegs. Luise mit Hut. Es kann so einfach sein. Mir gefallen die Ideen, die Schreibanregungen. Ich teile die Einschätzung von Frau Reichelt, dass es im Moment für viele schwieriger ist, zu schreiben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und vielleicht auch ähnlichen.
Sie sitzt in einer Schreibwerkstatt. Für traumatisierte Frauen. Solche wie sie. Als wäre sie etwas ganz besonderes. Aber ja doch. Wie viel vertrauter und sicherer sie sich fühlt, im Kreise von Frauen mit ähnlich traumatischen Erfahrungen. Ganz unabhängig von den Inhalten. Einfach ähnlich dramatisch, das ist irgendwie hilfreich. Um sich nicht wieder außen vor zu fühlen, wie in der Schulzeit. Oder ein bisschen seltsam, wie im Studium. Ein bisschen einsam, mit den Kindern auf dem überfüllten Spielplatz.
Ich bin müde, schreiben fällt mir schwer. Ich habe einen Tag ausgelassen, in meiner neuen Corona-Routine, wenigstens einmal am Tag zehn Minuten zu schreiben. Und schon wird es wieder schwierig, auch schon nur für diese zehn Minuten, mich hinzusetzen.
Wenn die Ängste überhand nehmen.
Wenn die Ängste überhand nehmen, kann ich nicht mehr schreiben, nicht mehr denken. Worte fehlen, Verbindungen fehlerhaft, keine vollständigen Sätze. Alles setzt aus. Bis blank. Blank. Und Blut. In Strömen. Wie in Filmen. Und es ist kein Film. Das Kind, vom Balkon, unter dem Auto, auf der Straße. Der Mann, verspätet, das Motorrad, die Autobahn. Die Freundin, die liebste. Und wieder das Kind. Das eine. Das andere. Mit dem Fahrrad. Im Wald. Vom Baum. Die Äste. Das Loch. Der schwarze Mann. Vom Waldrand. In meiner Kindheit hatte er eine Waffe. Ich habe ihn mehrmals gesehen. Ich war oft allein im Wald.
Essen hat noch jedes Kind gelernt.
Die Finger mit aller Kraft in den Wangentaschen. Der Schmerz. Bis die Zähne auseinanderrücken. Die andere Hand hält die Nase zu. Bis auch die Lippen auseinanderrücken. Es geht nicht anders. Und der nächste Bissen wird nachgeschoben.
Leber zum Beispiel. Angebrannte, knochentrocken gebratene Leber. Die im Mund aufquillt und aufquillt. Und sich nimmer schlucken lässt. Bis die Finger wieder drücken. Schmerz und Atemreflex sich abwechseln die Waage halten überwiegen den Ekel und Würgreflex.
Eine Ohrfeige, wenn es hochkam statt runterzugehen. Als wäre es mit Willenskraft und gutem Willen getan. Aufzuessen, freiwillig. Statt mit Zwangsmaßnahmen, die doch gar keiner wollte, natürlich nicht. Die sie sich ganz alleine sich selber zuzuschreiben hatte, ein schlimmes bösartiges Kind, andere wären längst beim Nachtisch.
Was hochkam, wurde wieder eingegeben. Irgendwann musste sie das ja lernen, essen hat noch jedes Kind gelernt. Und hier gab es nun mal, was auf den Tisch kam.
Sie zog die Atemmaske aus, wischte sich die Bilder aus dem Gesicht. Sie hatte sie lange nicht mehr ansehen müssen. Aber diese Atemnot, dieser Anflug von nicht ganz so gut atmen können unter den Masken, wie dünn auch immer der Stoff über Mund und Nase, dieser Anflug reichte, um so einiges wieder hochzuspülen.
Sie zieht sich die Maske aus, wischt die Bilder weg und lächelt ihre Freundin an. Heute hat sie sich jemanden mitgenommen. Sie lernt dazu. Mit einer Freundin an der Seite ist es so viel leichter, wegzuwischen, zu lächeln, und zu wissen, ganz tief drinnen, WIE VIELE Jahre das vorbei war.
schreiben. immer weiter schreiben.
schreiben.
immer weiter schreiben.
manchmal fällt es mir schwer.
oft fällt es mir schwer.
Es ist nicht so, dass ich keine Ideen hätte. Ich habe immer Texte im Kopf. Textanfänge, Sätze, halbe Texte, ganze Texte. Es ist nur, NUR dieser erste Anfang. Mich hinsetzen und losschreiben. Mich tatsächlich hinsetzen, ich mich, aus mir selber heraus.
Meine Arbeit ist Schreiben, welch ein Glück. Und wie schwer, immer wieder, mich hinzusetzen, nicht tausend andere Dinge zu tun. Seit Corona kann ich nicht mehr auswärts schreiben, und nicht mehr mit andern gemeinsam, keine festen Termine, keine Verbindlichkeiten. Ich fühle mich wie ein Kind, das sich zwingen soll, Hausaufgaben zu machen, jeden Tag, ohne Kontext der Schule, ohne die Freunde, wie soll das gehen. Ich jedenfalls, ich könnte es nicht. Oder nur mit Druck der Eltern, immer massiverem Druck der Eltern. Ich habe keine Eltern mehr, die mir befehlen, mich hinzusetzen und zu arbeiten. Schreiben zählt für sie auch nicht als Arbeit. Schreiben ist etwas für die Freizeit. Und auch dann nur, solange es nett und freundlich bleibt. Erbauliche Texte.
Erbauliche Texte habe ich noch nie geschrieben, auch als Kind nicht. Um erbauliche Texte für die Schule zu schreiben, musste ich abschreiben. Jahrelang ging das gut, bis ich mich an Thomas Mann versuchte. Leicht abgeändert, ein berühmter Text zum Meer, nach den Sommerferien, als Bericht über den „schönsten Tag der Ferien“. Ab da ging es nicht mehr gut. Von dem Punkt an wurden meine wunderschönen Texte strengstens begutachtet. Von nun an musste ich selber schreiben.
So richtig erbaulich wurden meine Texte danach nicht mehr, wunderschön auch nicht. Ich würde meine Texte ja nur so hinkotzen, was das denn sei, ich könne doch so viel mehr. Als ich mir dann Malina aussuchte, von der Bachmann, als Abschlusslektüre, sollte es mir verboten werden – das sei keine Literatur, das sei ja nur Hingekotztes. Wahrscheinlich nicht in genau diesen Worten, die Sprache war sicher gewählter, aber sinngemäß. Seither habe ich alle Beleidigungen zu meinen unschönen Texten als Kompliment aufgefasst, als Nähe zu Bachmann. Und es über die Schulleitung durchgekämpft, dass ich solch ein hässliches „modernes“ hingekotztes Werk wie Malina als Abschlusslektüre wählen durfte.
Auch Hingekotztes kann Literatur werden.
Einfach weiterschreiben.
Jeden Tag.
Vergessen werden.
Weite Felder, weiter Blick. Feldwege ohne Menschen. Sand unter den nackten Füßen, den Wind im Gesicht. Brandenburg. Im Frühjahr. Der Kuckuck ruft.
Meine Augen entspannen sich, bleiben in einer Weise weich, wie sie es in der Stadt nie sind. Diese Weite, durch die ich tagelang gehen kann, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Von Zeit zu Zeit ein Trecker, ein alter Lieferwagen, ein rostiger VW-Bus. Die Leute sind freundlich, ohne neugierig zu sein. Wenn die Polizei fragt, haben sie mich schon wieder vergessen.
Ich laufe und laufe, begegne keinem mehr, seit dem einen Trecker, heute morgen. Man begegnet hier nicht wirklich den Menschen, man begegnet den Treckern, den Lieferwagen, den Bussen. Der Trecker heute früh, das war ein grüner, ein großer, ein ziemlich neuer, für mein Laienauge. Ich kenne mich nicht aus, mit Treckern.
Der da drüben ist alt. Die solchen waren schon alt gewesen, als ich noch Kind war und oft bei den Bauern unterwegs. Die Bauern ringsum haben nicht viel gefragt. Wer mithelfen wollte, war willkommen. Wer mithalf, durfte mit am langen Tisch sitzen, in den Pausen, und von dem dicken Brot abbrechen, eine Schale Milch trinken.
Der alte Trecker gefällt mir, der scheint mir vertrauenswürdig. Hier wird keiner die Polizei rufen. Hier kann ich vielleicht über Nacht bleiben. Um morgen wieder weiter zu ziehen. Und vergessen zu werden.
sichtbar werden.
sichtbar werden mit Dingen, die nicht fertig sind. anfangen mit dem, was bereits da ist. und weitermachen. weitergehen. weiterschreiben. jeden Tag.
kleine öffentliche Unfertigkeiten
ich bin stabil. ich bin stabil. ich bin stabil. sie sagt es sich vor, jeden Tag.
ich darf das. ich darf. als müsste sie um Erlaubnis fragen, um zu dürfen. sie ist Mitte vierzig. wen sollte sie denn jetzt noch fragen. ihren Mann? ihre Mutter? oder ihre kleinen Kinder? die werden es ihr sagen. die sind sich sicher. Mama, du bist die beste.
mir diese kleinen öffentlichen Unfertigkeiten erlauben, jeden Tag. unfertig. kaum bearbeitet. nicht abgehangen. taufrisch. ohne darüber nachzudenken. ohne nochmals nachzulesen. einfach stehen lassen. zum nächsten gehen.
mit dem kleinstmöglichen Schritt beginnen. um dieses Gefühl zu verändern. ein Grundgefühl, aus der Kindheit mitgebracht. dass sie nichts schafft, nie etwas schaffen wird. dass sie nie fertig wird, mit nichts. und nie, NIE ausreichend gut.
wieder etwas erwarten von mir. auch wenn das bedeutet, wieder mehr Arbeit zu haben. jeden Tag. auch mit Schreiben.
sie setzt sich an ihren Schreibtisch. und beginnt.
In Berlin zuhause.
Ich erinnere mich, wie ich in Berlin ankam. Frühmorgens, mit dem Nachtzug. Mit einem letzten Rucksack und meinem neuen Rad, das mir mein Bruder extra alt geschenkt hat, für Berlin, damit es nicht gleich wieder weg ist. Das Rad war genau richtig, ich fahre immer noch damit. Die einzige Konzession an die Moderne ist ein Nabendynamo, den ich im langen Berliner Winter nicht mehr missen möchte.
Damals hat der Nachtzug am Bahnhof Zoo gehalten und ist danach quer durch die Stadt bis zum Ostbahnhof gefahren. Am Ostbahnhof stiegen nicht mehr viele Leute aus. Der Ostbahnhof war nicht sonderlich einladend. Ich schob mein Rad aus dem grauen Bahnhof ins graue Dämmerlicht, auf eine dicke Schicht Eis. Minus 20 Grad. Breitbeinig schob ich mein Rad nach Hause, in mein neues Zuhause, ein kleines Ofenheizungszimmer im Prenzlauer Berg. Ich fühlte mich zuhause wie noch nie zuvor in meinem Leben.
Es hatte nicht mit der Kälte zu tun, nicht mit dem Eis. Vielleicht ein wenig mit den breiten Straßen, dem vielen Platz. Das für mich so neue, so wunderbare Gefühl, das mit dieser Winterluft voller Kohlenrauch in mich einströmte: hier hast du Platz, hier darfst du sein, hier bist du richtig, hier kann jeder alles sein, keiner schaut dich schräg an, alles gut.
Und dann der Schock, am Nachmittag. Und danach jeden Tag, über viele Wochen. Dass ich in der Schweiz doch Deutsch geschrieben und gesprochen hatte, unsere offizielle Schrift- und Amtssprache, meine Muttersprache im Schreiben. Und ich war doch zum Schreiben hergekommen. Um endlich Schriftstellerin zu sein. Aber. ABER. Ich konnte kein Wort verstehen!
Ich bestellte einen Kaffee und musste dreimal sagen, was ich genau wollte. Offensichtlich klang es nicht deutsch, was ich sprach. Und was die Leute zu mir sagten, das konnte ich nicht verstehen. Es ging durch mich hindurch wie eine unbekannte Fremdsprache. Als wären die Zähnchen der Zahnrädchen auf ganz andere Geschwindigkeiten geeicht, griff Deutsch und Deutsch in meinem Kopf nicht ineinander.
Es hat viele Wochen gedauert, bis ich die Menschen so im Allgemeinen verstanden habe. Ich war über viele Wochen zutiefst verunsichert, im tiefsten Innern destabilisiert. Als hätte ich keinen Boden unter den Füßen, wenn mein Kopf ins Leere griff.
ABER. In Berlin war ich zuhause. In Berlin wollte ich leben.
Ich bin in Berlin geblieben.
Zum Kotzen.
Zum Kotzen. Schon den ganzen Tag. So ist es immer. Es muss auch nur eine Kleinigkeit wieder los sein, in ihrem althergestammten Herkunftsfamiliensystem. Über irgendwelche Wege erfährt sie es immer. Und schon kommt ihr das Kotzen hoch, die ganze Scheiße. Und diesmal, diesmal ist es keine Kleinigkeit. Diesmal droht es einen Menschen zu zerstören. Einen jungen. Einen der nächsten Generation. Und sie hatte doch gehofft, für die nächste wird es nicht mehr so schlimm sein.
Zum Kotzen. Sie sitzt und schreibt. Sie weiß nicht, was sie von dem Ganzen halten soll. Es kann ja auch ein Virus sein. Zurzeit reden ja alle von Viren. Naja, nicht Corona, ein anderer natürlich, einer fürs Kotzen. Es steigt hoch, seit dem frühen Morgen, immer wieder. Der Geschmack kommt an, im Mund, im Rachen. Der Rest lässt sich wieder schlucken. Der Geschmack bleibt. Der Geruch fehlt, aber die Erinnerung gaukelt auch den Geruch vor, mit dem Geschmack im Mund. Kotze ist unverkennbar.
Sie wollte nicht mehr über Kotze schreiben. Sie war doch über die Anfangsjahre des Schreibens längst hinaus. In denen alles ungefiltert aus ihr herausgebrochen kam. Kotze. Und Scheiße. Und Sperma. Und wilde Kombinationen von allem. Mit Blut, immer wieder. Und verlorenen Kindern. Ermordet.
Sie hat nicht mehr schreiben wollen, in diesen Phasen. Immer mal wieder. Hat monatelang Pause gemacht. Um unvermindert weiterzubrechen, sobald der Stift wieder über das Papier flog.
Sie will auch jetzt nicht schreiben, wenn ihr zum Kotzen ist. Wohin damit. Sie möchte einen Garten haben, unter dessen Büschen sie alles begraben könnte. Im Verborgenen. Diese Blütenpracht, mit solchem Dünger. Und keiner müsste sich mehr durch Scheiße wühlen, wenn er ihre Texte lesen will. Er oder sie könnte sich erfrischen. Und erfreuen. An Fliederbüschen. Violett, weiß, und gelb.
Und dieses Summen, dieses Duften. Die warme Sonne auf der Haut. Hinter den Hecken ein paar Kinderstimmen. Diese Kinder werden nicht mehr so sehr leiden, vielleicht. Und mehr die Blumen sehen, die Farben, das Licht.
Ich bin wütend.
Diese Trauer. Das ist furchtbar. Jetzt darf das Kind nicht in die Gruppe, in der ihre beste Freundin und ihre liebste Erzieherin sind. Weil die Gruppen nicht gemischt werden dürfen. Und wie soll ich mein Kind auf dem Spielplatz von ihrer besten Freundin fernhalten?
Not-Betreuung nennt sich das System. Alle sind unglücklich damit. Ich weiß nicht, was besser oder schlimmer ist. Ein Kind in der Not-Betreuung und jeden Tag zwei drei Stunden Stress- und Trauerbewältigung. Oder ein Kind nonstop zuhause und das zweite natürlich auch, denn jetzt werden die Geschwister in der Kita zusammengeklebt, auch wenn sie schon die ganzen Tage und die ganzen Wochen zusammengeklebt zuhause sein müssen und der Altersunterschied überhaupt nicht ideal ist für tagelange gemeinsame Spiele.
Ihr habt doch den Luxus der Betreuung, drei Halbtage pro Woche. Sei doch zufrieden. Es kann alles noch schlimmer werden. Ist das ein Trost? Mir ist es kein Trost. Ich finde all die Not-Systeme furchtbar. Alle sozialen Bezüge werden auseinander gebrochen, für die Kinder, für die Eltern. Auch für alle andern Menschen. Und sie sprechen von Öffnung, von Lockerung. In meinen Ohren klingt das zynisch.
Geöffnet werden die ganzen zusätzlichen Stressfaktoren, wieder ins Büro fahren, oder online wieder die volle Leistung bringen, parallel die Kinder weiterhin die meiste Zeit oder noch die gesamte Zeit selber betreuen, auch ohne Großeltern und Verwandte und Nachbarn. Ein Ding der Unmöglichkeit, Stress pur, mehr noch als im kompletten Lockdown. Und alles zwischenmenschliche, was uns trägt und stützt und nährt, soll auf Eis gelegt bleiben bis mindestens September. Ist das Öffnung?
Ich bin wütend. Und es hilft mir nicht.
All dieses Dürfen und Nichtdürfen, in unseren Leben. Wie zerbrechlich unsere Freiheiten sind, die wir gehabt und gelebt und geliebt haben.
Ein Wut-Text, heute. Kein literarischer.
Lachen.
Zähne putzen. Das Kind will nicht Zähne putzen. Erst recht nicht schlafen gehen. Die Spatzen lärmen noch, in den Hecken um den Sportplatz. Es ist noch hell. Kein Wunder, dass keiner schlafen möchte. Ich auch nicht. Lieber noch eine Runde lachen.
Lachen ist etwas, das mir nicht so oft gelingt. Und wenn ich lache, dann selten lange. Mit meinem jüngsten Kind dagegen, mit dem kann man richtig ausdauernd lachen. Auch ich.
Lachen, dass der Körper schüttelt. Das ganze Gesicht wie neu. Die Augen feucht, nicht vor Rührung, nicht von Trauer. Pures Lachen! Bis das Zwerchfell, die Lunge, das Herz nicht mehr kann, alles kurz aussetzt, Pause. Bis zur nächsten Lachsalve, Lachorgie.
Nach all dem Lachen ist plötzlich auch Zähneputzen in Ordnung. Es dämmert, die Spatzen schweigen. Jetzt singen die Amseln, hoch oben, in der Linde, auf den Dächern. Ich singe mit. Ein Gute-Nacht-Lied, ein zweites, ein drittes. Ich singe gerne, abends, an den Kinderbetten. Bis die Augen langsam zugehen, noch ein letztes Mal flattern, ein tiefer Atemzug, und ich weiß, jetzt, jetzt schlafen sie.
Schauen, staunen, selber atmen. Mit weichen Fingern über diese Wangen streichen, über diese weichen Händchen. Alle Spannung losgelassen. Ein Vertrauen, das ich in meinem eigenen Schlaf nicht kenne. Ich atme es ein, jeden Abend ein bisschen.
Ich öffne die Balkontür, zupfe verblühte Nelken und Glockenblumen, gieße die einen gelben, deren Namen ich nicht kenne, die immer so schnell trocken fallen. Leise singe ich nochmal ein Lied. Für mich. Betrachte die ersten Sterne. Denke an Fledermäuse und warme Sommernächte, an ein Glas Wein mit einer Freundin auf dem Balkon, an Schokokekse und warmen Tee.
Der Traum.
Über viele Jahre, Jahrzehnte, hat er den immer gleichen Traum geträumt. In dem Traum hat er sein noch leeres Grab besucht, auf dem Friedhof der Psychiatrie. Das Loch schon gegraben, Unkrautblumen am Rand, Farn in den steilen Wänden. Bereit, ihn jederzeit aufzunehmen. Jederzeit.
Seit ein paar Jahren hat er ihn nicht mehr geträumt, diesen Traum. Er denkt jetzt sogar, dass er alt werden könnte. Neunzig oder so. Gerade mal Halbzeit. So sehr hat sich sein Gefühl verändert, die Bilder und Vorstellungen. Das Grab in der Psychiatrie, das hat er schon beinahe vergessen.
Und nun hat es seinen Sohn erwischt.
Das Grab kriegt wieder Blumen. Das halb eingefallene Loch wird neu ausgehoben. Die Umgebung ist wild, wilder als früher. Der Friedhof kaum noch sichtbar, die Gräber verwildert. Das Gebäude daneben, die alten Mauern, die sind gleich geblieben. Mit den winzigen vergitterten Fensterchen.
Er träumt wieder. Nacht für Nacht. Und sieht seinen großen schönen starken Sohn ins Grab sinken, auf dem Friedhof der Psychiatrie. In das Grab, das eigentlich für ihn gewesen wäre. Das Grab ist zu klein für seinen Sohn, der Körper muss zusammengefaltet werden. Puppenspiel. Er spielt nicht.
Es regnet, das Loch füllt sich mit Wasser. Erde fließt den Wänden lang nach unten. Die Puppe schwimmt. Es ist längst nicht mehr sein Sohn. Es ist Großmutter und Großvater. Es ist seine Mutter, sein Bruder. Und immer wieder sein eigenes Gesicht. Im Wasser. Im Schlamm.
Er möchte nicht mehr träumen. Er war doch schon mal draußen gewesen.
Zeit zum Verschwenden.
Jetzt habe ich endlich zehn Minuten für mich. Heute hat es erst abends gereicht, wenn die Lampe schon brennt und die Kinder schlafen.
Neben mir liegt meine alte Postkarte. Mit der ich einmal mit viel Hoffnung Geld sammeln wollte für einen SchriftstellerLohn, Crowdfunding für Künstler. Der SchriftstellerLohn hat nicht geklappt. Aber die Karte gefällt mir immer noch. Links ein Bild mit einem Stapel Bücher, in schwarzweiß. Und daneben das Zitat von Ian McEvan: „Man braucht fürs Schreiben jede Menge Zeit zum Verschwenden.“
Zehn Minuten sind wunderbar. Und wenn der Tag so voll war wie heute, kein Raum für Verschwendung, keine Zeitecken und Zeitlücken. Dann ist es abends schwer, zu schreiben. Zusammenhängend. Am Stück.
Der Baum vor dem Fenster ist dunkelgrün geworden, beinahe über Nacht.
Einkaufen.
Sie kommt aus dem Laden und setzt sich auf den Poller. Ein großer Stein, Platz für zwei, es setzt sich kein zweiter. Sie ist allein. Sie nimmt nicht mehr wahr, wieviele Menschen um sie herum sind. Sie setzt sich, schweratmend, zieht sich die Maske vom Gesicht. Die Nase ist schweißnass, die Brille beschlagen. Hinter der Brille, die Augen, sind übergroß und schreckensstarr. Ihr Atem wird flach, verschwindet fast. Das Gesicht blasst ab. Sie sitzt und konzentriert sich auf die Steinkante, die sich in ihren Oberschenkel drückt. Diese eine einzige Sache, die sie gerade noch wahrnehmen kann.
Sobald sie wieder ein klein wenig was sieht, beginnt sie, alle Schuhe zu zählen, die vor ihr am Boden vorbeilaufen. eins und zwei. und drei und vier. rot. und braun. grün. und braun.
Bei siebenundzwanzig kommt der erste Atemzug. Das Gesicht nimmt ein wenig Farbe an, ein klein wenig. Sie schaut kurz auf, und gleich wieder runter. Sorgfältig beginnt sie nochmals bei eins, die Schuhe zu zählen, lässt den Kopf bei jedem Schuhpaar ein klein wenig mitgehen. Sie weiß, das hilft den Nackenmuskeln, diesen kleinen winzigen Stellmuskeln hinten an der Rückseite ihres Kopfes, sich wieder ein wenig zu lösen. Bei jedem Schuh ein bisschen. Sie hat so viel gelernt, in den letzten zwei Jahrzehnten.
Sie ist heute zum ersten Mal alleine einkaufen gegangen, überhaupt einkaufen, nach sechs Wochen. Sie arbeitet online, von zuhause aus, und hat sich liefern lassen, das wenige, was sie essen mochte, essen musste, in dieser Zeit. Doch nun hatte sich eine kleine Liste angesammelt von Dingen, die sie sich nicht so einfach liefern lassen konnte. Und nach sechs Wochen, da war es ihr nun auch nicht mehr recht, wieder ihre Freundin zu fragen, ob sie ihr nicht dies und jenes doch vielleicht nochmals mitbringen könnte. Beim letzten Mal hatte die Freundin einen selbstgenähten kleinen hübschen Stoff zu den Einkäufen gelegt, in Maskenform, mit zwei Gummibändern. Ohne Kommentar. So konnte sie es jetzt wohl nicht mehr vermeiden, sie musste es wenigstens versuchen.
Sie sitzt auf diesem Pollerstein, die Sonne im Gesicht. Sie spürt sie wieder, die Sonne. Aufstehen kann sie noch nicht, das Blut kribbelt, tausend Bläschen. Sie holt tief Luft und pustet lange lange gegen fast verschlossene Lippen. Lippenbremse, Atemtechniken, wie früher. Die Augen werden weicher, bewegen sich, beginnen plötzlich, wie gehetzt hin und her zu flitzen hinter den Gläsern, werden nur langsam ruhiger. Sie weiß, ihr Nervensystem orientiert sich. Sie hat so unendlich viel Theorie im Kopf, zu Nervensystem, und Triggern. Und konnte sich dann doch nicht helfen. Oder doch?
Sie war doch gerade einkaufen gegangen. Sie hatte es geschafft! Der Rucksack war gefüllt mit den paar Kleinigkeiten. Das teure Olivenöl drückte sich an ihre Rippen. Sie musste lachen. Eigentlich war es doch ganz in Ordnung, wie sie das hingekriegt hatte. Für eine wie sie. Mitten zwischen vermummten Menschen, in langen Schlangen. Stehen und warten. Nichts mehr sehen, weil die Gläser beschlagen. –
Halt. Stop. Schuhe zählen. eins zwei drei vier. braun. braun. schwarz. und rosa. Kleine rosa Kinderschuhe. Und eine helle hohe Kinderstimme. „Alles gut?“
Den Obdachlosen mit nach Hause nehmen.
Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer mal wieder den Impuls, den ein oder anderen obdachlosen, wohnungslosen Menschen mit nach Hause zu nehmen. Gerade wieder vermehrt, in dieser Zeit, in der sie so viel mehr noch ausgesetzt und alleine sind. Ausgeliefert ihren Traurigkeiten, ohne ein tröstendes Wort.
Wie selten legen wir Wohnungshabenden den Wohnungslosen eine Hand an die Schulter, an den Arm. Geschweige denn, dass wir ihn oder sie umarmen würden. Sie könnten dreckig sein und stinken. Sie könnten bei uns in der Wohnung plötzlich Dinge tun, die für die Kinder gar nicht gehen, oder gefährlich sind, wer weiß. Wie viele Ängste ich habe, ohne es zu wollen. Zugleich wirken sie überhaupt nicht gefährlich, die wenigen Obdachlosen, die ich ein wenig besser kenne. Nicht wirklich kenne, aber häufiger sehe, öfter bei ihnen stehen bleibe. Mit denen ich immer ein Lächeln tausche, manchmal ein paar Worte. Denen ich Geld gebe, wenn ich welches mithabe. Aber berühren, nein, berühren tue ich sie nicht.
Nur einmal, ein einziges Mal, da habe ich einen berührt, der betrunken war und stank, der immer da saß und mich anlächelte. Ich war mit meiner kleinen Tochter unterwegs. Sie stellte sich vor ihn hin und sagte hallo, legte ihm ihre kleine Hand aufs Knie und fragte, wie es ihm gehe. Schließlich kannten wir ihn. Sie mochte sein Lächeln, genau wie ich. Und dieses Kind stand vor diesem Mann, setzte sich neben ihn, redete mit ihm, legte ihm die Hand auf sein Knie. Dem Mann kamen die Tränen. Wasser floß, strömte diese Wangen hinunter. Das Kind wischte das Wasser weg, mit kleinen zarten Fingern, immer wieder. Ich stellte mich daneben und legte dem Mann eine Hand an die Schulter. Es fühlte sich an wie Großvater, Tochter, Enkelin. Er war nicht fremd. Er stank nicht mehr, wir rochen es nicht. Er wirkte nicht mehr betrunken.
Zurzeit fehlt er, wie so viele. Wir haben ihn immer wieder gesehen, über Jahre. Seit Corona ist er weg. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Ob er ein Land hat, wo er hingehen kann, einen Ort, einen Menschen, einen Platz in dieser Stadt.
Ich hoffe, er hat ein Kind gefunden, das ihn ganz ohne Zögern an die Hand genommen und durch ein kleines Türchen in einen Garten geführt hat. In dem Garten blühen jetzt die Fliederbüsche, in allen violett-Tönen. Mit betörendem Duft und diesem ständigen Summen der Bienen. Ein kleines Haus mit einem Bett. Kein Bier, aber das Kind stellt ihm jeden Tag ein wenig Essen hin. Wasser gibt es im Brunnen genug. Er beginnt, sich zu waschen. Und dem Kind die Hand zu geben, wenn es kommt. Gestern haben sie zum ersten Mal miteinander geredet. Sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie haben sich gut verstanden.
Wenn er wieder auftaucht, aus seinem Garten, wo immer er jetzt ist, werde ich meine Hand an seinen Arm legen. Und ihn fragen, ob er mitkommen möchte.
Der Bleistift meiner Großmutter.
Heute schreibe ich mit dem Bleistift von meiner Großmutter. Die Bleistifte von Großmutter stehen in dem kleinen Holzbecher, in dem sie immer in ihrer Küche gestanden haben. Sie sind fein säuberlich angespitzt, noch von Großmutters Hand. Der Holzbecher bemalt, auch von Großmutters Hand, mit winzigstem Pinsel, mit wunderbaren kleinen Blumen. Ich kann nicht so malen. Meine Großmutter wäre gerne Malerin geworden, sie hatte das Talent dazu. Sie hätte die Hartnäckigkeit gehabt, die mir manchmal fehlt, den starken Willen, eisern. Sie wäre eine gute Malerin geworden, da bin ich mir sicher. Aber dann kam der Krieg. Und alles war anders.
Als sie bereits Großmutter war, hat sie zum ersten Mal wieder kleine feine Pinsel in die Hände genommen. Blumen gemalt und Menschen. Alte Bilder nachgemalt, als wären es Originale.
Mein Kind weint, auf dem Spielplatz draußen. Der Bleistift von Großmutter gleitet zäh und viel zu langsam. Wird stumpf dabei. Und verliert die Hand von Großmutter, die eben gerade noch darauf gelegen hat, bevor ich diese fein säuberlich angespitzte Spitze aufs Papier gesetzt habe.
Ich werde wieder mit meinen Druckbleistiften schreiben, die Bleistifte von Großmutter zurück ins Regal stellen. Ich hänge an den Bleistiften, weil sie in Großmutters Küche gestanden haben, jahrzehntelang. Immer, IMMER frisch angespitzt. Und weil meine Großmutter damit geschrieben hat, jeden Tag. Einkaufslisten, kleine handgerissene Zettelchen. Und die Einträge im Geburtstagskalender, mit immer mehr Todestagen zwischen den Geburtstagen. Bis es kaum noch freie Tage gab im Jahr.
In der Erde wühlen. Mit den Händen.
Manchmal gibt es jetzt Tage, da bin ich pessimistisch. So müde. Und so pessimistisch. Dann höre ich Trump, mit seinen Beweisen gegen China, und sehe den nächsten Weltkrieg. China gegen Amerika, oder Amerika gegen China. Mit so seltsamen Allianzen wie China und Korea. Ich habe keine Ahnung politisch. Auch Russland könnte sich anschließen. Und wo bleibt dann Europa? Oder Mutter Erde? Wird sie übrig bleiben, unsere Erde, um darin zu wühlen und Blumen zu pflanzen und Samen auszusäen?
Kleine Pflänzchen, die ich jedes Jahr bewundere und bestaune, wenn sie ihre Keimblätter durch die Schicht Erde stoßen, mit solch einer Kraft. Und sich entfalten, mit diesen ersten zwei Blättern, um erst in den nächsten dann ihre Form zu finden, ihre ganz eigentliche Blattform, an der ich sie bestimmen kann, Eigenschaft um Eigenschaft in riesigen Verzweigungsbäumen.
Ich habe mein Wissen verloren, all die Pflanzennamen, die mal gespeichert waren, in meinem Kopf. Aber dieses in-der-Erde-Wühlen, in jedem Frühjahr, in jedem Herbst, das ist mir geblieben. Dieses Auge für das Wunder, wenn überwinterte Pflänzchen und Knollen wieder austreiben, die verstreuten Samen von Ringelblumen und Akelei ihre Würzelchen treiben, sich festwurzeln, ihre Köpfchen heben, die ersten Keimblätter treiben. Und die Akelei vom letzten Jahr bereits wieder Blüten trägt, im Hof, und bald ihre Samen verstreuen wird. Im ewigen Wechsel. Ewig.
Ich könnte schon beinahe wieder optimistisch werden.
Im Hof wird morgen oder übermorgen die erste Rose sich öffnen, vor dem Wein, an der sonnigsten Wand. Wir haben nicht viel Sonne im Hof, ein Berliner Hinterhof. Und es reicht. Für Glück. Und Optimismus.
Vielleicht sollten wir alle ein kleines Beet haben, im Hof. Oder um die Bäume vor den Häusern. Oder wenigstens auf dem Balkon oder vor dem Fenster, am Fenstersims. Ein paar Samen einsäen, gießen, warten. Die ersten Blättchen. Und so viel Kraft, die Erde zu heben. Die Welt zu verändern. Den Planeten zu durchwurzeln, wie der Baobab beim kleinen Prinzen, wenn er ihn wachsen lassen würde. Und bald nichts anderes mehr auf dem kleinen Planeten wäre. Als Baum.
Umarmungen
Heute hat mich eine Oma auf dem Spielplatz umarmt und auf die Wange geküsst. Ich hatte Tränen in den Augen. Es ist nicht erlaubt. Und es war wunderschön! Mein ganzer Körper, jede Zelle hat gerufen: mehr davon, bitte mehr davon!
Ich vermisse die Umarmungen, von Freunden, von Nachbarn, von Müttern und Vätern und Omas auf dem Spielplatz. Ich wollte nicht über all das schreiben, was fehlt zurzeit. Und doch wird es so überdeutlich, sobald jemand das Tabu bricht, die Verordnung übertritt und sich menschlich verhält, zutiefst menschlich. Wir sind soziale Wesen, wir benötigen soziale Kontakte und physische Berührungen, existentiell, überlebensnotwendig, wie jedes Säugetier, auch der Mensch. Und nicht nur als Säugling, sondern immer, die Erwachsenen ebenso. Das ist Nervensystem.
Ich gehe in Richtung Trampolin, dort hüpfen meine Kinder. Plötzlich entdecken sie mich. Mama! Zwei Lockenkinder rennen auf mich zu, in den einen Arm, in den andern. Eine jubelnde Dreierumarmung. Wie schön! UND – ich hätte sie kaum wahrgenommen. Weil ich zurzeit zuviel davon kriege, von diesen Kinderumarmungen.
Aber heute hatte ich eine Freundin getroffen, zum Spazierengehen. Sie stand daneben, als meine Kinder auf mich zu gerannt kamen. Meine Freundin hält sich an die Verordnungen, sie wohnt alleine und vermisst Umarmungen, überhaupt irgend einen körperlichen Kontakt mit andern. Sie stand daneben, als meine zwei Lockenkinder sich an mich pressten, ich sie zurück presste, wir in dieser Dreierumarmung waren. Und plötzlich konnte ich wieder wahrnehmen, wieviel das ist. Welch ein Geschenk! Kinder um mich zu haben, in diesen furchtbaren Zeiten, in diesen zutiefst unmenschlichen Sozialkontaktbeschränkungen.
Sosehr ich mir oft und jeden Tag ein bisschen mehr Raum für mich wünschen würde – und nur für mich, für mich ganz allein – sosehr stand ich in dieser Dreierumarmung und konnte plötzlich wieder das Glück wahrnehmen. Jede Zelle, die sich öffnet. Und atmet. Haut an Haut. Als gäbe es keine Kleider. Fellhaare. Zwei winzige Äffchen, die sich einklammern in mein Fell. Wie warm sie sind. Wie sehr sie beschützt sein müssen, in allen Situationen. Auch in solchen.
Und Schutz könnte bedeuten, sie öfter Umarmungen auszusetzen, Verordnungen hin oder her. Schutz könnte bedeuten, mich selber öfter Umarmungen auszusetzen. Und das schlechte Gewissen einzustampfen. Weil wir nicht überleben können, ohne Umarmungen. Weder ich. Noch die Kinder.
Rhythmus. Musik. Schreiben.
Meine Hände am Stift, ein kleines Wunder. Ich konnte den Stift nie so führen wie man sollte. Den Bleistift, den Füller. Immer war mein Zeigefinger eingeknickt, mit viel zu viel Druck. Der harte Knubbel am Mittelfinger, den ich mir immer wieder abgebissen habe, flachgebissen die ganze Hornhaut. Ich habe gerne Hornhaut gegessen, lange auf den Stückchen rumgekaut. Es hat mich beruhigt. Es beruhigt mich heute noch.
Den Knubbel gibt es immer noch, am Mittelfinger. Auch den eingeknickten Zeigefinger. Nur der Druck ist weniger geworden, weicher. Ich schreibe wieder mit Bleistift, wie als Kind, aber mit Druckbleistift, 0,5, fast ohne Druck. Der Stift gleitet weich. Aber das Aufsetzen, dieses ständige Aufsetzen nach jedem zweiten dritten Buchstaben, wo die Buchstaben nicht nahtlos zusammengehängt sind, dieses Aufsetzen ist hart. Und laut. Und schnell. Ein Klopfen, ein Pochen, ein rasendes Herz. Im Rhythmus des Schreibens. Ganzkörperrhythmus. Der Atem passt sich den Sätzen an. Die Bewegungen der Musik. Wie Flöte spielen oder Klavier oder Cello. Nirgends kann ich still stehen, still sitzen. Nur singend. Wenn ich singe, bewege ich mich kaum. Wenn ich singe, werde ich ruhig.
Sogar die Kinder werden ruhig, wenn ich singe. Statt meine wilden Improvisationen, in den Texten, mit den Stiften. Auf dem Klavier, mit den Tasten. Die Saiten, die sich einschneiden. Das Cello so ruhig, und mein Rhythmus so wild, mit dem Bogen über dem Steg. Mit dem Stift auf dem Papier. Und der Specht, im Baum vor dem Fenster. Mitten in der Stadt. In Berlin.
Wenn ich singen könnte, im Schreiben. Singen, jubilieren. In die höchsten Höhen, in die tiefsten Tiefen. Bis die Tiefe nicht mehr beängstigend ist, sondern einfach nur tief und ruhig und dunkel. Bis ich vielleicht schlafen kann, trotz Corona. Und der Sand rieselt weiter, in meiner kleinen Kindersanduhr. In rosa. Ich habe Zeit zum Schreiben. Zeit zum Singen im Schreiben. Zehn Minuten pro Tag.
Wir alle könnten sie uns nehmen, die Zeit. Zum Singen, zum Schreiben, zum Musik machen. Bis wir wieder ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn wir uns begegnen draußen. Noch ohne Mundschutz, zwischen den Bäumen, im Park, zwischen den Häusern, auf der Straße. Ein Lächeln, ein Melodiefetzen, ein Kinderlied. Das leise Grüßen, das leise freundliche Gespräch. Ein feines Nicken, ein Weitersingen. Wir lassen ihn los, den Corona-Stress. Die Spannung. Das Atemanhalten.
Ich schließe die Augen, schreibe blind. Der Stift wird langsam, das Klopfen weich. Der Specht schweigt. Ich werde noch singen, heute, für meine Kinder, wenn ich sie ins Bett bringe. Das Herz ist ruhig. Ich atme wieder.
Der Höhenmesser. Von Großvater.
Heute habe ich den alten Höhenmesser von meinem Großvater gefunden. Er hat damit im Krieg seine Männer durch die Berge geführt. Gebirgsbataillon. Ich sehe ihn ziehen, mit seinen Mannen, in grünem Tuch, über die Gletscher, einer an den anderen geseilt, eine lange Reihe vereinzelter kleiner Zielpunkte auf weißem Feld. Das Seil nass und schwer. Voran mein Großvater, mit Karte und Kompass und Höhenmesser. Mit den Karten im Kopf, jeder Felsen jede Gletscherspalte bekannt. Und doch kann der Gletscher der Fels von Tag zu Tag anders sein.
Drüben, über der Grenze, fällt ein Fliegerpilot. Er hat einen Fallschirm. Aber der Fallschirm brennt. Ein schwarzes Pünktchen fällt ins Eis. Die Italiener haben ihn runtergeholt. Das Flugzeug zerschellt, verschwunden, der Berg schluckt viel, auch einen verbrannten Piloten. Der liegt auf der anderen Seite der Grenze. Mein Großvater führt seine Männer zurück in den Bunker. Feierabend für heute, es dunkelt bereits.
Ich weiß nicht, wie es war, für Großvater, abends wieder in den kalten Bunker zu klettern. Mit solchen Bildern auf der Netzhaut. Ich weiß nur, dass es eine der ganz wenigen Erinnerungen aus dem Krieg ist, die mein Großvater mir erzählt hat. In den Tagen, als er das meiste schon vergessen hatte, sich nicht mehr zurecht fand, mich nicht mehr kannte. Da hat er mir erzählt, von diesem brennenden schwarzen Pünktchen. Das vom Himmel fiel. Und ein Loch in den Gletscher brannte. Während er mit seinen Mannen über die Berge zog, die Grenze sichernd, am Seil verbunden. Und abends neben dem Gletscher in diesen kleinen kalten Bunker kroch, die Stahltür zuzog, als letzter. Den Metallriegel sicherte. Und nicht schlafen konnte, nachts. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Der Höhenmesser funktioniert noch immer. Ein Thommen. „Qualitätsware“, hätte mein Großvater gesagt. Er wäre stolz auf seinen Höhenmesser, könnte er jetzt sehen, wie genau der Zeiger die 52 Meter anzeigt. 52 Meter über dem Meer. Berlin Wedding. Weit weg von den Bergen.
Das Hörspiel. Die Langeweile.
Plötzlich ist es still. Das Hörspiel ist für die Große. Der Kleine ist ebenso still. Mit riesigen Augen. Bei mir liefen die Hörspiele von kleinen runden Schallplatten. Mit Nadel, die an der richtigen Stelle aufsetzen musste. Und Kratzgeräuschen bei jedem Stäubchen.
Das Anpusten der schwarzen Scheiben. Mit weichem Staubtuch sanft trocken reiben. Wieder auflegen. Die Nadel justieren. Den Hebel umlegen. Und die Spannung, ob die Nadel in der richtigen Rille aufkommt. Damit die Geschichte weitergehen konnte.
Oder die Kassetten. Mit den braunen Bändern. Die wir rausgezogen haben. Und mit dem kleinen Finger zwischen den kleinen weißen Zähnchen dann das Band minutiös, Windung um Windung, wieder aufgezogen.
Das Geräusch des Deckels, am Kassettendeck. Die leicht quäkenden Stimmen der Märchentanten. Und auch ich, große Augen, still gehaltenen Körper, kaum Atem. Und diese Aufregung, nachher, wenn die Geschichte zu Ende war.
Ich erinnere mich an dieses Kribbeln im Blut. Und an das Gefühl von sofortiger tödlicher Langeweile – wenn nicht sofort, sofort!, die nächste Kassette, die nächste Platte, oder wenigstens ein Freund eine Freundin zum Spielen –
Mich an anderem festhalten. Schreibend.
Corona. Ich möchte nicht über Corona schreiben. Von Corona lese und höre ich Tag für Tag. Viel zu viel. Sogar mit meiner Freundin am Telefon haben wir von Corona gesprochen. Fast die gesamte Zeit. All die Corona-Themen, die unseren Alltag durchziehen.
Ich möchte mich fernhalten. Mich an anderem festhalten. Schreibend. Bis tatsächlich wieder anderes auftaucht. Und Corona zurückdrängt. Vielleicht. Mit der Zeit.
Zehn Minuten. Jeden Tag.
Ich werde eine kleine Sanduhr auf meinen Tisch stellen. An manchen Tagen werde ich sehnsüchtig dem Sand beim Rieseln zusehen. An andern Tagen die Zeit vergessen und viel zu viel schreiben.
Lasst euch überraschen. Ich mich auch.
Corona-Blog. Ich auch. Zehn Minuten pro Tag.
Ich bin Schriftstellerin. Mit groß angelegten Romanprojekten. Die auch schon gefördert wurden. An denen ich weiterschreiben möchte. Oder sollte. Und nicht kann. Denn jetzt haben wir Corona.
Corona. Die Kinder zuhause. Den ganzen Tag. Jeden Tag. Ich weiß nicht, wie andere neben Kindern arbeiten können. Abends? Abends bin ich zu müde.
Aber zehn Minuten? Nur zehn Minuten? Müssten zehn Minuten nicht eigentlich drin liegen, auch jeden Tag?